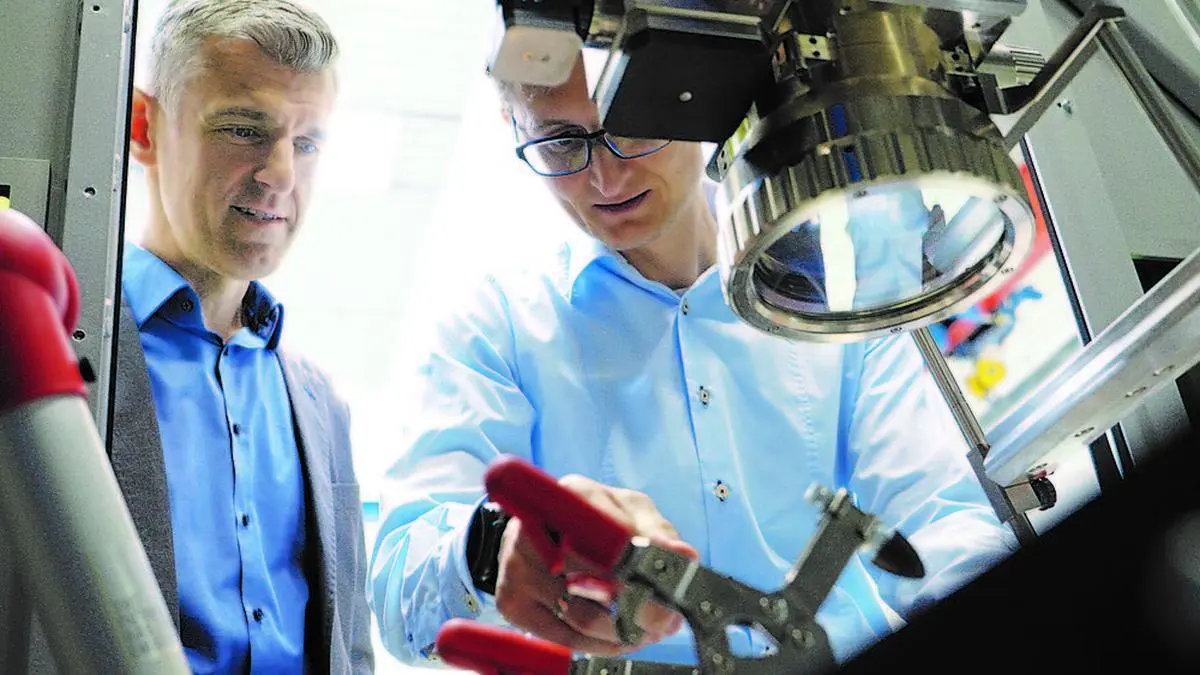Man muss es gleich an den Anfang stellen, damit kein Missverständnis aufkommt: Rosendahl-Nextrom im oststeirischen Pischelsdorf erzeugt nicht selbst Batterien. Aber es entwickelt, erzeugt und liefert weltweit Anlagen an Firmen aus, die damit ihrerseits Batterien erzeugen. „Unser Ausgangsprodukt sind fertige Batteriezellen“, erläutert Alexander Schweighofer, der für die junge Sparte der Anlagen für Lithium-Ionen-Batterien zuständig ist. Bisher war man vor allem für klassische Auto- und Industriebatterien tätig, aber mit den Lithium-Ionen-Batterien gibt es plötzlich ganz neue Herausforderungen.
„Es gibt in dem Bereich überhaupt keine Normen“, berichtet Schweighofer. Jeder Batteriekunde (etwa die Autobauer) will seine ganz spezifischen Batterien; die Batterien sind nicht einmal innerhalb eines Autoherstellers gleich.
Die Anlagen der Oststeirer decken zwei wesentliche Schritte der Batterieherstellung ab: Zum einen die Verbindung mehrerer Batteriezellen zu Modulen. Die Zellen kommen dabei in drei wesentlichen Typen vor: Zylindrisch, prismatisch und als sogenannte Pouch-Zellen (flach, mit Aluminium ummantelt, in Handys beispielsweise eingesetzt).
Die Module werden dann zum anderen zu Akkumulatoren („Packs“) gebündelt. In beiden Stufen gibt es allerdings verschiedene Herstellungsschritte. Die Zellen müssen verklebt werden, sie erhalten Steuerelektronik, Kühlsysteme und ein Gehäuse. Jede Anwendung hat verschiedene Erfordernisse, was die Entwicklung der Produktionsanlagen relativ komplex macht.
„Lithium-Ionen-Batterien sind eine ganz andere Herausforderung als klassische Bleisäure-Batterien“, betont Schweighofer. Es sind viel mehr differenzierte Produktionsschritte notwendig, die Vorschriften sind (wegen der Entzündungsgefahr) wesentlich komplexer. „Das Thema Sicherheit spielt bei Lithium-Ionen-Batterien eine herausragende Rolle“, so Schweighofer. Es muss etwa gesichert sein, dass auch bei Problemen Belegschaft und Maschinen geschützt sind. Im Brandfall werden die Module verkapselt und evakuiert.
Auch die Qualitätssicherung ist deutlich anspruchsvoller als bei klassischen Batterien. Es gibt strenge Rückverfolgungs- und Nachweispflichten zu beachten, die Toleranzen sind wesentlich kleiner. Da geht es um die Schweißqualität, um die Dichtheit, um exakte Drehmomente und Drehwinkel bei Verschraubungen. Das Laserschweißen, das immer gängiger wird, erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen.
Der Trend geht außerdem hin zu Fertigungsanlagen, die rasch auf andere Produkte umgerüstet werden können – die „Eier legende Wollmilchsau wird gesucht“, seufzt Schweighofer.
Das Geschäft boomt und gilt als zukunftssicher, international, aber auch im Großraum Graz ist man gut vernetzt. Und ja: „Wir haben immer Bedarf an Technikern“.