Was hat aus Ihrer Sicht als Komplexitätsforscher während der letzten Jahre gut funktioniert?
PETER KLIMEK: Wir waren nur ein kleiner Teil des Systems, das für Österreich gearbeitet hat. Dieses Reporting bzw. Forecasting-System, mit dem Konsortiums-Ansatz und der Zusammenarbeit mehrerer Institute, das hat funktioniert und da braucht sich Österreich eigentlich nicht zu verstecken. Außerdem gab es aus Österreich eine Reihe von sehr gut gemachten Studien, die auch international Niederschlag fanden. Hier konnten wir zeigen, was die Wissenschaft beitragen kann.
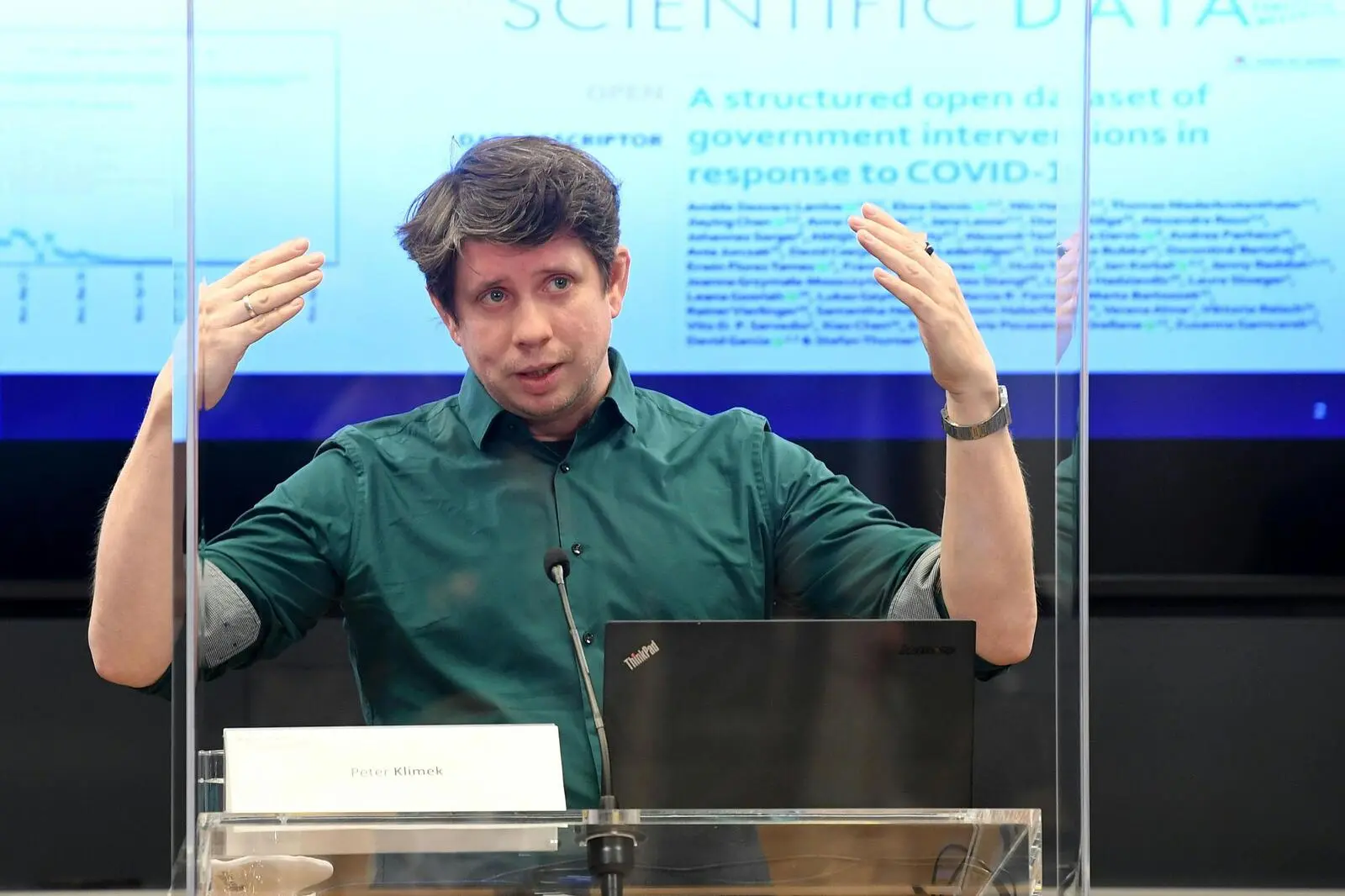
© APA/HELMUT FOHRINGER
© APA/HELMUT FOHRINGER
Komplexitätsforscher Klimek
"Es ist nicht die Rolle der Wissenschaft zu sagen, ob die Schulen auf oder zu sein sollen"
Zum Lesen scrollen
Komplexitätsforscher Peter Klimek zieht Bilanz über eine Pandemie, die am Übergang in die nächste Phase ist. Ein Gespräch über fehlende Daten, Schulschließungen und den schwierigen Blick in den Rückspiegel.


