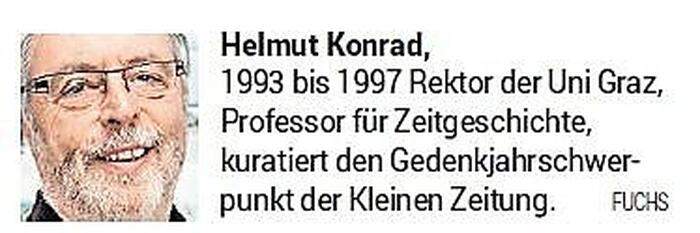Am 21. Oktober 1919 entstand mit der Ratifizierung des Friedensvertrages von Saint-Germain die Republik Österreich, wie das Land ab diesem Zeitpunkt hieß. Damit wurde der dramatische Neugestaltungsprozess, der am 12. November 1918 begonnen hatte, formell beendet. Dennoch war noch manche Frage offen. In Kärnten ging es noch um die Südgrenze, und die westungarischen Komitate und damit die Grenzziehung zu Ungarn waren noch offen. Im Inneren des Staates wurde um eine Verfassung gerungen und auch die Bundesländer hatten ihre Landesverfassungen zu demokratisieren.
Der Sozialdemokrat Karl Renner stand seit der „Österreichischen Revolution“ vom November 1918 einer Koalitionsregierung vor. Diese hatte nicht nur in Paris den Friedensvertrag zu verhandeln, die Grenzen des Staates zu definieren, eine Verfassung zu entwickeln, sondern auch das Elend von weiten Teilen der Bevölkerung zu lindern und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Zudem galt es, den schmalen Grat zwischen einer revolutionären Stimmung auf der Straße und einer Verantwortung für das demokratische Gefüge des Staates zu bewältigen. Dies gelang nicht zuletzt durch eine beispielhafte Sozialgesetzgebung, die mitten im Elend Österreich zu einem vorbildlichen Sozialstaat machte. Vor allem aber hatte die dramatische Veränderung das Wahlrecht für die Frauen unseres Landes gebracht, lange bevor etwa in England die weibliche Bevölkerungshälfte zu den Urnen durfte. Aber noch immer wurden hungernde Kinder, vor allem aus der Großstadt Wien, zur Verbesserung ihrer Gesundheit nach Dänemark oder Holland geschickt und in den Städten grassierte die Tuberkulose.

Emotional war das Hauptproblem aber das Fehlen einer österreichischen Identität. Praktisch das gesamte Parlament hatte sich in der Konstituierung dafür ausgesprochen, dass das Land Teil des demokratischen Deutschland sein sollte. Die Friedensverträge erzwangen die Unabhängigkeit, aber Staat und Nation waren in diesen Jahren nicht deckungsgleich. Dass Österreich „ein Staat, den keiner wollte“, war, ist dennoch übertrieben. Das, was die dramatischen ersten Jahre der Republik Österreich gebracht hatten, wurde von konservativer Seite sehr bald als „revolutionärer Schutt“ bezeichnet, während zumindest Teile der Linken die eben errungene Demokratie nur als Übergangsphase auf dem Weg zum Sozialismus sahen.
Am 1. Oktober 1920 beschloss der Nationalrat die österreichische Bundesverfassung, deren Schaffung das letzte große Gemeinschaftswerk der Parteien bleiben sollte. Die Verfassung stammte weitgehend aus der Feder Hans Kelsens, Ordinarius für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien. Sie kann als demokratische Musterverfassung angesehen werden, die ein strenges Verhältniswahlrecht vorsah und einen Ausgleich zwischen den zentralistischen Vorstellungen der Sozialdemokraten und den föderalistischen Grundsätzen der Christlichsozialen Partei zu finden hatte. Es entstand ein „zentralistischer Bundesstaat“ mit einer schwachen Position des Bundespräsidenten, dessen Rolle 1929 in einer Novelle aber deutlich gestärkt werden sollte. In dieser Form trat die Verfassung auch nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft 1945 als Grundlage für die Zweite Republik wieder in Kraft.
Man sieht die Erste Republik im Rückblick aus den ökonomischen, sozialen und politischen Erfolgen der Zweiten Republik nur allzu leicht als Negativfolie, als einen Staat, von dem man sich abzugrenzen hatte. Das Zusammenrücken der großen politischen Lager in der Zweiten Republik scheint das Gegenmodell zu den Konfliktaustragungen in der Vorgängerrepublik zu sein. Das ist richtig, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Vielfach steht die Zweite Republik auf den Schultern der Ersten, wie etwa in der Verfassungsfrage, in anderen Bereichen war man im Vergleich zur Zwischenkriegszeit sogar deutlich provinzieller. Das galt vor allem für die Bereiche Kunst, Kultur und Wissenschaft. Hier war in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg das Nachwirken der Monarchie noch stark zu spüren. So räumten die Universitäten Wien und Graz bei den Nobelpreisen damals noch deutlich ab. Fritz Pregl (1923), Richard Zsigmondy (1925), Julius Wagner-Jauregg (1927), Karl Landsteiner (1930), Erwin Schrödinger (1933), Victor Franz Hess (1936) und Otto Loewi (1936) stellten wenigstens jedes dritte Jahr die österreichische Wissenschaft ins Rampenlicht. Die Salzburger Festspiele als Friedensprojekt, gegründet von Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss, wurden zum Tempel der Hochkultur. Stefan Zweig, Joseph Roth, Franz Werfel, Robert Musil, Anton Wildgans und Franz Kafka spielten in der ersten Liga der Weltliteratur. Auch nach dem Tod von Gustav Klimt und Egon Schiele war die bildende Kunst mit der Sezession und den Wiener Werkstätten am Radar der kunstsinnigen Weltöffentlichkeit.

Österreichs Wirtschaft sah sich in der Ersten Republik einem fast unüberwindbaren Berg von Problemen gegenüber. Man hatte einen Großteil der Staatsschulden der Monarchie zu übernehmen und der Friedensvertrag sah zudem Reparationszahlungen vor. Die Kohlereviere und die Hafenanlagen waren nun im Ausland und der lebendige Wirtschaftsraum der Monarchie war durch die neuen Grenzen zerstückelt.
Dazu kam eine gewaltige Nachkriegsinflation. Allein im August 1921 stiegen die Preise für Lebensmittel um 124 Prozent und am Ende des Jahres 1921 hatte die Krone nur noch einen Wert, der den Wert von 1914 um das 14.000-Fache überstieg. Die Sparer verloren damit praktisch alles, Anleihen und Sparbücher waren nur noch wertloses Papier.
Der Regierung Ignaz Seipel gelang es, im Oktober 1922 eine Völkerbundanleihe zu erreichen, die sogenannten Genfer Protokolle, die Österreichs Wirtschaft mit 650 Millionen Goldkronen sanierte und die von den Regierungen in Großbritannien, Frankreich, Italien und der Tschechoslowakei garantiert wurde. Österreich musste seine Zölle und sein Tabakmonopol verpfänden. Österreich bekam aber seine ökonomischen Probleme damit kurzzeitig in den Griff, und das erlaubte es der Regierung, mit dem Jahresende 1924 die Schillingwährung einzuführen und alles vorhandene Barvermögen im Verhältnis von 10.000 zu 1 zu tauschen. Hart war er, der Schilling, aber zu erwischen war er schwer, sollte sich Jahrzehnte später der Herr Karl an diese neue Währung erinnern.
Die ersten Wahlen in der jungen Republik im Jahr 1919, erstmals mit den Stimmen der Frauen und mit 85 Prozent Wahlbeteiligung (ein Wert, der in der Folgezeit noch steigen sollte), sahen die Sozialdemokratie als Sieger mit fast 41 Prozent, gefolgt von der Christlichsozialen Partei mit 36 Prozent. Die deutschnationalen Parteien errangen knapp 21 Prozent. Aber schon die Wahlen des Folgejahres stellten das Kräfteverhältnis zwischen den beiden großen Parteien praktisch auf den Kopf und erlaubten es den Konservativen, die Koalition zu verlassen und mit dem deutschnationalen Lager zu koalieren. Die Verfassung wurde noch gemeinsam beschlossen, aber dann sahen sich die Sozialdemokraten für den Rest der Ersten Republik von der bundespolitischen Verantwortung ausgeschlossen. Umso stärker waren sie bemüht, im Roten Wien ihren gesellschaftspolitischen Gegenentwurf zu realisieren. Der Gegensatz Wien – Bundesländer war politischer und kultureller Natur, Zukunftsmodelle und Gesellschaftsentwürfe standen sich diametral gegenüber.
Im Parlament standen sich die Parteien unversöhnlich gegenüber. Otto Bauer, ein Meister der radikalen Rede (die sogenannte „radikale Phrase“ der Sozialdemokratie hatte immerhin dazu geführt, dass die Kommunisten praktisch bedeutungslos blieben und nie im Parlament oder aber im Wiener Gemeinderat auch nur einen Sitz erreichen konnten), saß Ignaz Seipel gegenüber, der von 1921 bis 1930 christlichsozialer Parteiobmann war und zweimal als Bundeskanzler agieren konnte. Der Priester und Intellektuelle war der Kontrahent des aus begütertem jüdischem Elternhaus stammenden führenden Austromarxisten, deren Wortgefechte zeugen vom hohen Niveau einer aufgeheizten politischen Diskussion.
Die Sozialdemokratie gab sich 1926 ihr Linzer Programm, ein Text, der die politischen Gegner nicht zuletzt deshalb verstörte, da er vorsah, Großkapital und Großgrundbesitz zu enteignen, vor allem aber dadurch, dass es als Ziel formuliert wurde, die „Klassenherrschaft der Bourgeoisie zu brechen“, und dass zur Verteidigung der Demokratie gegen monarchistische oder faschistische Gegenrevolutionen auch ein Bürgerkrieg nicht ausgeschlossen wurde. Das bot Zündstoff und Angriffsflächen und die Diskussionen wurden nicht nur in den Abgeordnetenhäusern, sondern auch auf der Straße oder in den Wirtshäusern mit Leidenschaft geführt.
Der Erste Weltkrieg hatte einen bemerkenswerten Rückschritt im „Prozess der Zivilisation“, wie es Norbert Elias in seinem berühmten Text formulierte, gebracht. Der Staat hatte sein Gewaltmonopol eingebüßt und die Gewaltbereitschaft war durch die Kriegserlebnisse im Schützengraben vor allem in der jungen männlichen Gesellschaft angestiegen.
Viele der von den Fronten zurückströmenden Soldaten sahen keine Veranlassung, ihre Waffen abzugeben, zumal der Staatssekretär für das Heerwesen, der Sozialdemokrat Julius Deutsch, von manchen als „jüdischer Bolschewik“ angesehen wurde, demgegenüber man nicht zur Loyalität verpflichtet war. Zudem gab es offene Grenzfragen, die mit Waffen ausgetragen wurden, und es gab Plünderungen der hungrigen Stadtbevölkerung in den Dörfern. So formierten sich die ersten Heimatwehren, die bald zu den „Heimwehren“ zusammengefasst wurden und die dominant christlichsozial oder national ausgerichtet waren. Politisch orientierte man sich vor allem an den „fasci di combattimento“, den Kampfeinheiten der italienischen Faschisten, die erfolgreich ihren Marsch auf Rom durchgeführt hatten und der italienischen Linken eine vernichtende Niederlage zugefügt hatten.
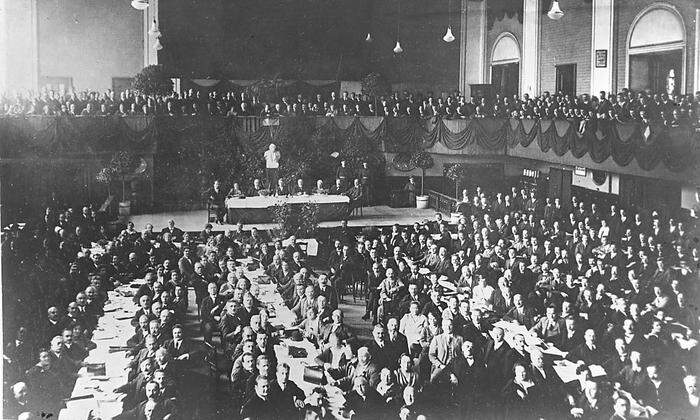
Die Sozialdemokraten hatten als Antwort darauf bewaffnete Arbeiterwehren formiert und nach dem Ausscheiden aus der Koalitionsregierung begann man, diese paramilitärisch zu organisieren. 1923 war schließlich daraus der Republikanische Schutzbund entstanden, der nicht mehr nur als Ordner- und Schutzorganisation für sozialdemokratische Veranstaltungen agierte, sondern sich zunehmend als Instrument der Verteidigung der Demokratie und ihrer Weiterentwicklung hin zu einem nebulosen Sozialismus verstand. Man trug Uniformen und hatte sich ebenfalls aus alten Armeebeständen bewaffnet. Um 1928 hatten sich in den Heimwehren fast 100.000 Mann organisiert, im Schutzbund etwa 80.000. Das Bundesheer durfte nur aus 10.000 Mann bestehen, sodass die Wehrverbände zusammen das Achtzehnfache der regulären Armee, allerdings bei deutlich schlechterer Bewaffnung, an Mannschaftsstärke stellen konnten. Es ging vor allem um die Dominanz im öffentlichen Raum, um das Sichtbarmachen der eigenen Stärke und die Beherrschung des öffentlichen Diskurses. Dass es zu Zwischenfällen, zum Aufeinandertreffen und letztlich zu physischer Gewalt kommen musste, das lag auf der Hand. Die Hemmschwelle zum Einsatz von Fäusten und Waffen war gering und es gab in der gesamten Zwischenkriegszeit nur ein einziges Jahr, in dem nicht zumindest ein politisches Opfer tot auf Österreichs Straßen lag.
Diese aufgeheizten Gegensätze verdecken allzu leicht, dass das Gesamtbild dieser ersten Jahre nicht nur in dunklen Farben gezeichnet werden sollte. Der Befund ist vielmehr ambivalent. Österreich hatte sich zumindest zeitweise als lebensfähig erwiesen, die Demokratie hielt, im Gegensatz zu den meisten anderen Nachfolgestaaten der Monarchie, den Erschütterungen stand und in Wissenschaft, Kunst und Kultur hatte Österreich auch weiterhin Weltgeltung. Die „Welt von gestern“ war auch in den Zwanzigerjahren noch nicht vollständig Vergangenheit.