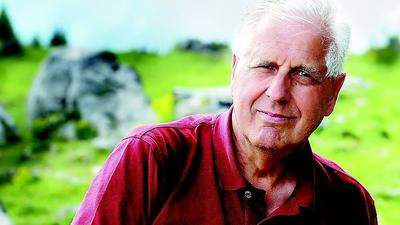Mit dem Thema Pflege greift die türkis-blaue Bundesregierung endlich ein Thema an, bei dem es nicht nur um Türschild- und Symbolpolitik geht, sondern das die Existenz Hunderttausender berührt. Fast eine Million Österreicherinnen und Österreich pflegen Angehörige zu Hause - das geht von Besorgungen und der Hilfe im Haushalt bis zur 24-Stunden-Pflege des dementen Vaters.
460.000 Österreicherinnen und Österreicher haben Anspruch auf Pflegegeld - das sind diejenigen, die sich eingestehen, dass sie Hilfe brauchen und bereit sind, diese Hilfsbedürftigkeit auch gegenüber anderen zu dokumentieren. Viele zögern dieses Eingeständnis der eigenen Schwäche, der Abhängigkeit von anderen, und seien es die eigenen Söhne und Töchter, lange hinaus.
Rendi-Wagners SPÖ-Programm: Positive Stimmung, Kraft und Mut
130.000 Österreicherinnen und Österreicher leiden unter Demenz. Die Belastung für ihre Angehörigen, die im späteren Stadium rund um die Uhr dafür sorgen müssen, dass ihre Liebsten sich und anderen nichts antun, ist immens.
Die Zahl der 80-Jährigen schließlich, bei denen davon auszugehen ist, dass sie nach und nach zumindest Unterstützungsleistungen brauchen, um den Alltag zu bewältigen, steigt bis zum Jahr 2030 von derzeit fünf auf sieben Prozent an.
Die Regierung stellt ihren Masterplan unter das Motto "Daheim statt Heim": Die pflegenden Angehörigen sollen so unterstützt werden, dass die Pflege mit Begleitung funktioniert und das Heim nur der letzte Ausweg ist.
Es ist bemerkenswert, wie gut die Österreicherinnen und Österreicher die Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft bewältigen. Der Staat hilft, aber er hilft nicht genug.
Berufstätige Angehörige unterstützen
Die Kinder sind heute meist noch selbst berufstätig, wenn ihre Eltern Unterstützung brauchen. Wenn sie zu Hause bleiben oder in Teilzeit arbeiten, gefährden sie ihre eigene Existenz, riskieren Armut im Alter. Der Staat gleicht das Risiko nicht aus.
Für pflegende Angehörige gibt es die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, ohne Einkommen, dafür aber übernimmt die Sozialversicherung des zu Pflegenden die Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge. Diese Person muss es sich alledings leisten können, nicht nur sich selbst sondern auch die Lebenshaltungskosten auch des Ehepartners zum Beispiel zu bestreiten. Es gibt Sozialleistungen des Staates, aber sie decken dieses Aspekt nicht ausreichend ab. Voraussetzung ist außerdem, dass der zu Pflegende selbst versichert war - im Fall der inzwischen Gott sei Dank auch älter werdenden Menschen mit Behinderten ist das meist nicht der Fall.
Netzwerke stärken
Für Menschen, die keine 24-Stunden-Pflege, aber Begleitung brauchen, gibt es funktionierende Unterstützungssysteme. Systeme, die es auch Menschen, deren pflegebedürftige Angehörige weit weg leben, aus der Ferne mit begleiten zu können. Hauskrankenpflege, Pflegedienste, das Notfall-Armband, Essen auf Rädern, ehrenamtliche Palliativteams, auch Einspringer bei Krankheit oder auch Urlaubsbedürfnis der Angehörigen - all das gehört dazu.
Aber zum einen stehen diese Dienste nicht überall zur Verfügung. Zum zweiten sind sie nicht für alle leistbar. Und zum dritten wurden Assistenzmöglichkeiten zuletzt aufgrund der finanziellen Nöte der Gemeinden und Sozialhilfeverbände sogar wieder eingespart. Insbesondere jene Leistungen, die den Betroffenen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, Taxigutscheine beispielsweise, teure unterstützende Geräte, etc.
Pflegerinnen respektieren
Die 24-Stunden-Pflege schließlich ist unter normalen Bedingungen, also als reguläres Beschäftigungsverhältnis, für normale Menschen in Österreich, also Durchschnittsverdiener, nicht leistbar. Ausschließlich die vielen Pflegerinnen aus Ungarn, der Slowakei, Rumänien halten den Betrieb derzeit aufrecht. Frauen, die froh sind, bei uns Arbeit zu finden, die dafür aber auch unendliche Mühsal auf sich nehmen: Sie lassen ihre eigenen Männer und Kinder zurück.
Sie nehmen alle zwei oder drei Wochen Taxidienste in Anspruch, die sie zuweilen sogar das Leben kosten, weil die Fahrer jenseits aller Vorschriften innerhalb kürzester Zeit eine Hunderte Kilometer umfassende Tour erledigen.
Ihnen hat diese Regierung zuletzt ihre Wertschätzung versagt, indem sie ihnen die Familienbeihilfe gekürzt hat und sie in plakativen Werbesujets als dunkelhäutige unerwünschte Ausländer mit Kopftuch diskreditiert hat.
Erst wenn türkis und blau beginnen, Menschen wie ihnen die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen, werden sie glaubhaft im Bemühen, für die Österreicherinnnen und Österreicher dauerhaft Sicherheit in Bezug auf die Absicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit zu geben.
Finanzierung sichern
Bleibt schließlich noch die Finanzierung, ein Thema, über das seit Jahrzehnten gestritten wird, das eine Lösung bisher verhindert hat. Es ist dieser Regierung nicht vorzuwerfen, dass auch sie noch keine Lösung hat sondern sich im Wege einer Studie an eine solche herantasten will. Rund 4,6 Milliarden gibt der Staat derzeit für die Pflege aus, rund 2,6 Milliarden der Bund für das Pflegegeld und die 24-Stunden-Betreuung, 2,05 Milliarden entfallen auf die Länder. Und es ist immer noch viel zu wenig, die Angebote fehlen an allen Ecken und Enden, insbesondere im ländlichen Raum.
Es braucht Geld. Es braucht ein flächendeckendes Case-and-Care-Management, also Personen, an die man sich wenden kann und die die entsprechenden Angebote vermitteln, und es braucht klare Verantwortungen. Derzeit wird der Schwarze Peter zwischen Bund, Ländern und Gemeinden hin und her geschoben, das ist keine Lösung.
Das Nötige für alle
Ob Pflegeversicherung oder Geld aus dem Steuertopf, ist letztlich eine zweitrangige Frage, nur die Beschränkung auf eine so genannte "Versicherungspflicht" darf es nicht werden. Denn kommt es zu einer Mehrklassengesellschaft, die daraus entsteht, dass sich nicht alle alles leisten können, dass nicht alle Versicherer alle Risken freiwillig übernehmen wollen.
Das Pflegerisiko ist so zu behandeln wie das Krankheitsrisiko und das Pensionsrisiko: Das Nötige für alle, der Luxus für die, die es sich leisten können.
Anlaufstellen für Betroffene
Bestimmend für die Grenze, für die Entscheidung, was dieses Nötige ist, darf nicht der Umstand sein, wieviel einer verdient, sondern diese Grenze muss eine unabhängige Anlaufstelle, eben dieses "Case-and-Care-Management" bestimmen.
Das alles muss nicht neu erfunden werden. In manchen Städten und Sozialhilfeverbänden funktioniert es bereits, einzelne Länder haben vorbildliche Systeme geschaffen. Doch nicht für alle und nicht mit den nötigen Mitteln.
Ein weites Feld, das sich diese Regierung vorgenommen hat, zu beackern, und ein wichtiges für die, die sie gewählt haben. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache schreiten heute zur Tat. Sie beginnen mit dem Bekenntnis, dieses Thema ernst zu nehmen und an einer Lösung zu arbeiten. Es ist ein wichtiger Schritt.
Von Tabus befreien
Entscheidend für das Gelingen wird sein, wie sehr sie sich dabei auch von Tabus befreien, ob sie es sich erlauben, Lösungen abseits politischer Justament-Standpunkte zu finden. Dazu gehört der Umgang mit Ausländerinnen, die zum System gehören, das Nachdenken über Steuern, die man bisher ablehnte, die Freiheit der Gedanken in Bezug auf Umwidmungen bei den Lohnnebenkosten, die Bereitschaft, die Notwendigkeit von Sozialleistungen zu akzeptieren, ohne gleich die "soziale Hängematte" vor Augen zu haben.