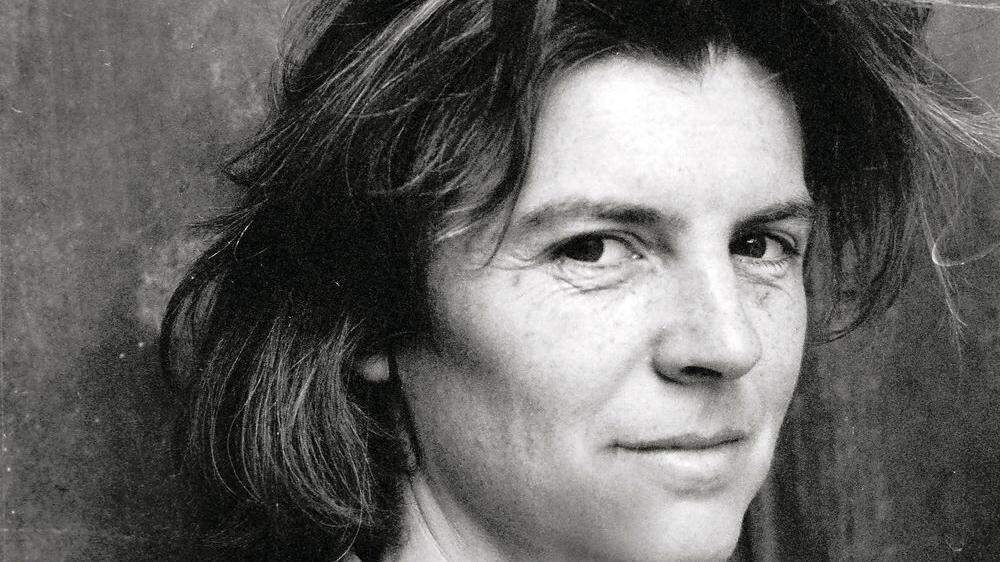Sie sind Jonke-Preisträgerin 2021. Was bedeutet Ihnen dieser Preis im Namen des Kärntner Dichters?
ANN COTTEN: Ich bin sehr dankbar und gerührt! Und traurig, dass Gert Jonke so früh gestorben ist. Ein Gelegenheitsgespräch mit ihm ist mir gut in Erinnerung geblieben. Schon als Schülerin hat mich sein einzigartiger Stil sehr beeindruckt.
Was macht ihn einzigartig?
Er schreibt so präzise Sätze, sehr experimentell, aber auch konkret, gesellschaftskritisch, dabei war er ungemein höflich und charmant, eine tolle Kombination! Ich kenne keinen, der solche Sätze schreibt. Es macht mich sehr froh und ist ermutigend für meine Arbeit, weil viele Leute zu mir sagen: "Warum schreiben Sie so kompliziert? Schreiben Sie doch einmal was Einfaches, was jeder versteht!“ Man ist dann dankbar, wenn es auch eine Minderheit gibt, die weiß, was man tut und warum.
So etwas kennt Friederike Mayröcker vermutlich auch ...
Aber Mayröcker arbeitet mit einem anderen Instrumentarium, viel mit Bildern, aber es ist nicht diese syntaktische Geometrie. Ich habe das Gefühl, dass Mayröcker sozusagen das Mischgefäß ihrer eigenen Wahrnehmung ist, etwas sehr Persönliches. Bei Gert Jonke sehe ich, dass er sich persönlich fast rausnimmt, dass er die Sprache als allgemeines Tool verwendet, das jeder benutzen kann. Bei ihm finde ich wenig Persönliches, das ist eines der Dinge, die mir so gut gefallen.
Sie selbst kommen aus zwei Sprachwelten, schreiben in und übersetzen aus Deutsch und Englisch. Wie ist das Verhältnis?
Deutsch ist die Sprache, in der ich sozialisiert bin, in der ich mir im Umgang mit Menschen leichter tue. Aber ich war eines der Kinder, die mehr lasen, als mit anderen zu spielen. Zum Glück standen zu Hause Shakespeares Gesamtwerk und Lyrik-Anthologien. Da konnte ich im Englischen ganz wild und ungestört von schulischer Bildung rumabenteuern. Dadurch habe ich einen eher wilden Bezug zur englischen Sprache. Shakespeare und die elisabethanischen Dichter, einfach alles, was mir gefallen hat, wuchert in meinem Kopf herum. Das muss ich kontrollieren, jetzt, wo ich versuche, für meine Dissertation akademisch auf Englisch zu schreiben.
Sie waren auch in der Poetry-Slam-Szene aktiv?
Ich mochte diese Slams, die Mieze Medusa in Wien aufgebaut hat. Als ich in Berlin war, merkte ich: Das ist eine viel professionalisiertere Szene, als mir das gefällt. Leute performen denselben Text 20, 50 Mal, mir würde da fad. Ich liebe die schrägen Leute, die aus ihren Winkeln kriechen wie ich selber und merkwürdige Texte auf die Bühne stellen.
Sie schreiben Lyrik und Prosa. Wann schreiben Sie was?
Derzeit eher Prosa. Das Spannende bei Lyrik ist, dass nicht ausgemacht ist, warum man etwas schreibt. Da kommt etwas raus, eine Formidee, die sich mit einem Instinkt verbindet, manchmal merkt man erst später, warum das interessant war. In letzter Zeit habe ich drei, vier Gedichte pro Jahr geschrieben und denke, dass es so intensiver wird. Da ist weniger Geplapper und mehr dran, wenn sich eine Idee Bahn bricht.
Für wen schreiben Sie?
Menschen, die sowieso dasselbe wichtig finden wie ich, muss ich nicht überzeugen. Den Ort, wo Spracharbeit nützlich sein kann, sehe ich bei den Leuten, die etwas machen, woran sie selbst nicht richtig glauben und meinen, es geht nicht anders. Das ist vielleicht das, was mein Schreiben kann: zeigen, dass es auch anders geht.