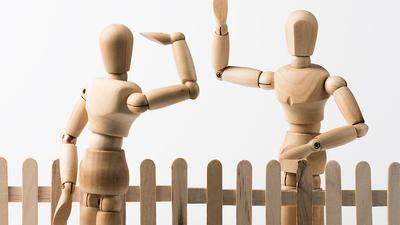Im Papier des EU-Gipfels ist von „regionalen Anlauf-Plattformen in enger Kooperation mit relevanten Drittstaaten“ die Rede. Doch jeder weiß, was und wer gemeint ist.
Denn im Streit um eine bessere Kontrolle der EU-Außengrenzen schweift der Blick aus Brüssel auch jetzt wieder zu den arabischen Mittelmeeranrainern in Nordafrika - Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko. Um die Zahl der Flüchtlinge und Migranten zu senken, möchte Europa auf deren Territorien Auffangzentren einrichten, wo Ankommende registriert und ihr Asylanliegen geprüft werden kann.
Aus der Sicht Europas eine einleuchtende Lösung, weil sie die gefährlichen Bootsüberfahrten zu Wasser beenden und schon außerhalb der EU-Grenzen diejenigen identifizieren, die keine Chance auf Asyl oder Anerkennung als Flüchtling haben. Man würde den Schleppern das Handwerk legen und müsste gleichzeitig die Abgelehnten nicht mehr in umständlichen Verfahren von Europa aus abschieben.
Noch mit niemandem gesprochen
Mit den arabischen Partnern gesprochen hat bisher jedoch niemand, entsprechend gereizt sind die Antworten aus den Hauptstädten Nordafrikas. Im Fokus der Europäer steht vor allem Libyen, von dem aus bisher die meisten Menschen auf die Boote gingen. Das Land ist tief gespalten, in vielen Regionen dominieren bewaffnete Milizen.
In Tripolis sitzt die international anerkannte Regierung unter Premierminister Fayez al-Sarraj. Im Osten herrscht Ex-General Khalifa Haftar mit seiner „Libyschen Nationalarmee“. Für die Regierung in Tripolis stellte Vizeregierungschef Ahmed Maiteeg noch einmal klar, man sei gegen jedwede Flüchtlingslager in Libyen. Das Gleiche denkt sein Machtrivale Haftar.
Ähnlich kategorisch ablehnend reagierten auch Ägypten, Marokko und Tunesien. Tunesien ist bisher kein Durchgangsland für afrikanische Migranten. Die meisten, die von seiner Küste nach Italien übersetzen, sind Einheimische. Die Gesellschaft Tunesiens sei schon jetzt geprägt von weitverbreiteter politischer und wirtschaftlicher Unzufriedenheit, erklärte Stefano M. Torelli, Migrationsexperte beim „European Council on Foreign Relations“.
Angst vor Staatskrise
In dieser Situation könnte eine große Zahl Flüchtlinge aus Afrika südlich der Sahara Unruhen oder gar eine Staatskrise auslösen. „Unsere Antwort ist ein klares Nein“, erklärte dann auch Tahar Sherif, Tunesiens Botschafter in Brüssel. „Wir haben we
der die Möglichkeit noch die Mittel, dies zu managen.“
Als „leichtfertig und kontraproduktiv“ bezeichnete auch Marokkos Außenminister Nasser Bourita die EU-Vorschläge. „Marokko hat stets und lehnt auch jetzt solche Methoden ab, um den Strom der Migranten zu managen“, erklärte er in Rabat.
Nachbar Algerien, der bewusst von der EU keine Hilfsgelder für Flüchtlinge annimmt, dagegen schickt Migranten möglichst umgehend nach Hause zurück. Seit Monaten verhaften Algeriens Sicherheitskräfte systematisch Zuwanderer aus Subsahara-Afrika, verladen sie in Busse und transportieren sie in Richtung Mali und Niger. 14.000 Menschen, darunter Frauen und Kinder, wurden in der Wüste ausgesetzt und mussten in sengender Hitze zu Fuß über die Grenze gehen - ein Vorgehen, das von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert wird.
Migranten seien „eine Quelle von Kriminalität und Drogen“, begründete dagegen Ministerpräsident Ahmed Ouyahia seinen rabiaten Kurs. „Das algerische Volk muss vor Chaos geschützt werden.“