"Tempus fugit". Die Zeit flieht. Nur nicht im Lockdown: Da scheint sich bei vielen Menschen ein gänzlich neues Zeitempfinden einzustellen. Statt den ganzen Tag unterwegs zu sein, verbringt man plötzlich viel Zeit zuhause und widmet sich längst vergessenen Hobbys oder anderen Dingen, die einem Freude bereiten. Aber was ist das Zeitgefühl eigentlich?
Das subjektive Zeitgefühl
Mit der Zeit ist es so eine Sache. Fragt man beispielsweise Kinder danach, wie sich eine Stunde für sie anfühlt, erhält man vermutlich eine vollkommen andere Antwort als die eines Erwachsenen. „Das Zeitgefühl hat immer mit einer subjektiven Wahrnehmung zu tun und nicht mit einer objektiven Wirklichkeit“, erklärt Zeitforscher Franz J. Schweifer. Jeder Mensch nimmt Zeit entsprechend unterschiedlich wahr.

Gleichzeitig kann das individuelle Zeitgefühl widersprüchlich sein: "Mal ist es ein sehr bedrückendes, mal ein sehr beglückendes, dann wieder ein göttlich ewiges oder ein teuflisch kurzes", so der Experte. Er geht davon aus, dass sich durch die Ausgangsbeschränkungen im Lockdown die subjektive Einstellung des Einzelnen zur Zeit verändere. Man würde viel eher lernen, was wesentlich für einen selbst sei.
Mangelware Zeit?
Außerhalb des Lockdowns begleitet einen hingegen nicht selten das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben: Warum kommt es eigentlich zu diesem Mangeldenken? "Die Zeit konfrontiert uns mit unserer Endlichkeit", so Schweifer. Die Zeit sei entsprechend nicht zu kurz, sondern die Bedürfnisliste des Menschen schlicht zu lang.
"Wir leben in einer 'Zuvielisation'", sagt Schweifer und lädt zu einem Gedankenexperiment ein: "Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem 'Running Sushi'-Lokal. Wir sind zwar nicht dafür verantwortlich, was in welcher Geschwindigkeit daher kommt - im übertragenen Sinne können das neben Essen und anderen Verführungen auch Mails oder Aufgaben sein - aber wir sind ein Stück weit dafür verantwortlich, wann, wo und wie oft wir in unserem gedachten 'Running Sushi' zugreifen. In dem Zusammenhang sollte man sich auch überlegen: Ist es sinnvoll, jetzt zuzugreifen? So oft zuzugreifen? Ich bin vielleicht schon satt."
Mehr kostbare Zeit in neuen Jahr: So klappt's
Wer sich von diesem Mangeldenken verabschieden möchte, dem empfiehlt der Zeitphilosoph, sich darüber bewusst zu werden, welche wesentlichen Bedürfnisse man hat. Hilfreich dazu sei auch das Einüben einer Reduktionskompetenz, beispielsweise mit Hilfe des genannten Gedankenexperimentes. Die Reduktion auf wesentliche Dinge könne dazu beitragen, sich selbst als Mensch zu erleben, der in der Fülle ist: "Sich bewusst zu machen, was ich schon alles hab und nicht, was alles nicht da ist."
"Schriftlichkeit schafft Verbindlichkeit"
Als besonders empfehlenswert für regelmäßige Rituale sieht der Zeitforscher manuelle oder taktile Tätigkeiten an. Hat man beispielsweise etwas gemalt oder gebastelt, stelle sich eine unmittelbare Rückkoppelung von Erfolg ein. Das wiederum sei wesentlich für ein gutes Zeitgefühl: "Etwas erfolgreich hergestellt zu haben, selbstwirksam geworden zu sein, das macht unser Zeitgefühl greifbarer und spürbarer." Insbesondere geistig arbeitende Menschen würden die investierte Zeit häufig nicht spüren. Ein entsprechendes Hobby als Ausgleich könne da sehr hilfreich sein.
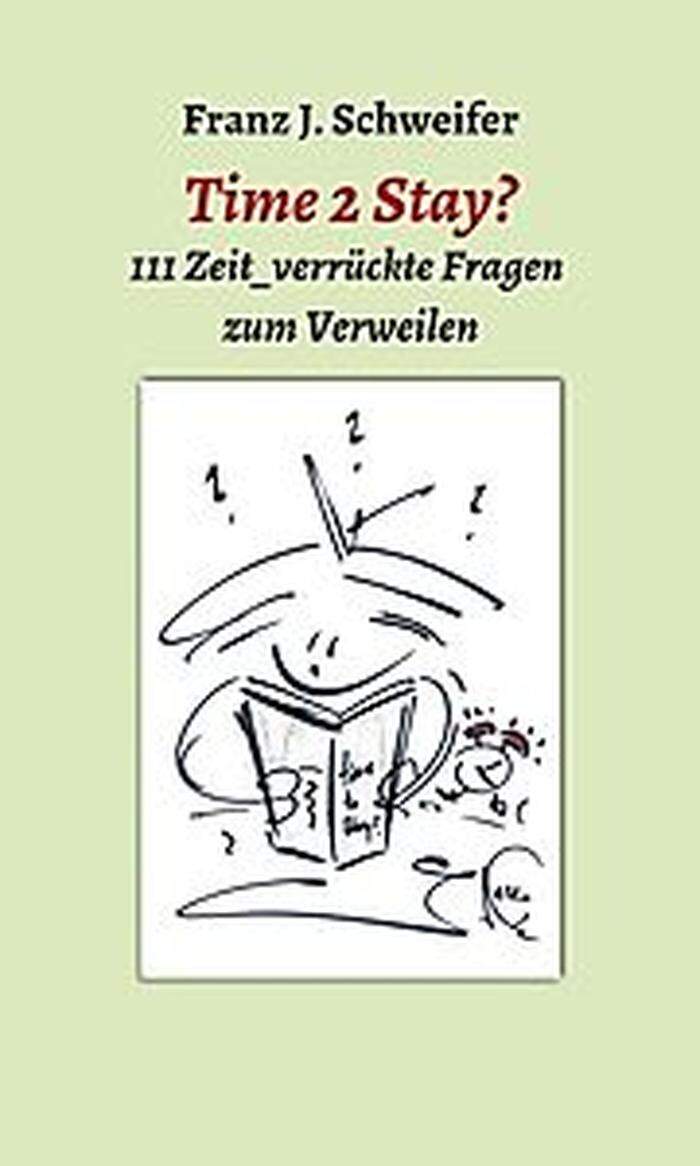
Damit es nicht nur beim Vorsatz bleibt, rät Schweifer dazu, sich selbst einen Brief oder eine Nachricht mit den Dingen zu schreiben, für die man sich im neuen Jahr mehr Zeit nehmen möchte. "Schriftlichkeit schafft mehr Verbindlichkeit, auch sich selbst gegenüber." Dadurch falle es leichter, dem neuen Ritual regelmäßig Platz im Kalender einzuräumen.
Pflichtlose Zeit
Auch Gesundheits- und Arbeitspsychologe Roman Sander plädiert für Auszeiten im Alltag: "Ein konkreter Tipp ist es, sich am Tag eine pflichtlose Viertelstunde zu nehmen." In dieser Zeit sollte jedoch auf ein Kontrastprogramm zur Haupttätigkeit des Tages geachtet werden. Hat man den ganzen Tag körperlich gearbeitet, wäre es zum Beispiel ein guter Kontrast, am Abend ein Buch zu lesen.

Wichtig dabei ist, dass die pflichtlose Zeit tatsächlich ohne Pflicht bleibt: "Bemerke ich beim Lesen, dass ich keine Lust mehr habe und beginne nachzuschauen, wie viele Seiten das Kapitel noch hat, fängt die Pflicht wieder an. Bevor man das Kapitel fertig liest, obwohl man keine Lust hat mehr, sollte man das Buch lieber zuklappen."
Mehr Auszeiten = Mehr Zufriedenheit
Mehr Auszeiten wirken sich auch auf das Wohlbefinden aus. Es sei nachgewiesen, dass Menschen, die sich regelmäßige und bewusst geplante Auszeiten - pflichtlose Zeiten - nehmen, glücklicher und zufrieden wären, sagt Sander und fügt schmunzelnd hinzu: "Wenn man ganz ehrlich mit sich ist, wird man sowieso nie fertig mit dem, was man sich vorgenommen hat. Weder in der Arbeit, noch privat. Und wenn man eh schon nicht fertig wird, kann man sich ja auch zusätzlich jeden Tag die Viertelstunde pflichtlose Zeit gönnen".

