Ihr neues Buch, mit mehr als 1000 Seiten das dickste bisher, heißt "Der letzte Sessellift". Es ist: Familienroman, Geistergeschichte, ein Buch über Familiengeheimnisse – und natürlich ein Roman über das Skifahren. Wie kamen Sie auf diese Geschichte?
JOHN IRVING: Ja, das ist mein längster Roman. Aber es fiel mir dennoch sehr leicht, ihn zu schreiben. Ich habe dafür nichts lernen, nichts recherchieren müssen, das sich außerhalb meines Erfahrungshorizonts befindet. Ich habe schon kürzere Romane geschrieben, für die ich länger gebraucht habe. Zum Beispiel „Gottes Werk und Teufels Beitrag“. Für dieses Buch habe ich drei Jahre lang über Medizingeschichte gelernt.
Bei "Der letzte Sessellift" war es anders?
Dafür brauchte ich "nur" sechs Jahre. Warum? Weil ich in einer Familie von Skifahrern aufgewachsen bin. Und die Skischule in New Hampshire, in die ich als Kind gegangen bin, war die Schule von Hannes Schneider. Er war österreichischer Skipionier vom Arlberg und Schauspieler, hat sich in den 1930er-Jahren mit den Nazis angelegt, emigrierte 1939 in die USA und eröffnete am Mount Cranmore eine Skischule. Dort habe ich Skifahren gelernt.
Der Roman ist noch autobiografischer als Ihre anderen Romane?
Am Anfang, ja. Meine Romane sind ja meist Familiensagen. Und es ist nicht das erste Mal, dass Familienverhältnisse im Mittelpunkt stehen: der fehlende Vater, die geheimnisvolle Mutter. Was aber dann passiert, unterscheidet sich sehr von meinen anderen Büchern. Nahezu alle Menschen in diesem Roman sind queer, bis auf Adam, den Erzähler. Ich habe das Ganze aber umgedreht, und die queeren Menschen sind alle "normaler" als Adam. Üblicherweise ist es ja so, dass Familienmitglieder, die homosexuell, lesbisch oder transgender sind, als Außenseiter gelten. In diesem Roman ist allerdings der vermeintlich normale Typ jener, der das seltsamste Verhalten an den Tag legt.
Sie haben sich als Autor und auch als Privatperson schon mit "Queer People", der LGBTQ+-Community und Diversität beschäftigt, lange bevor diese Themen in der allgemeinen Wahrnehmung gelandet sind. Jetzt wird breit darüber gesprochen. Ist dadurch auch die Toleranz gestiegen?
Das Gegenteil passiert. In den USA gibt es in der Sexualpolitik eindeutig einen Rückschlag. Das betrifft sowohl die Frauenrechte als auch die Rechte für die LGBTQ+-Community. Als ich ein Teenager war, war meine Mutter eine Aktivistin für Frauenrechte. Sie war Hilfskrankenschwester in einem Familienzentrum. Und ein Großteil ihrer Arbeit bestand darin, mit jungen, unverheirateten, schwangeren Frauen zu sprechen. Sie hat diese Arbeit zu einer Zeit gemacht, bevor Abtreibungen legal und sicher waren. Später wurde es legalisiert, aber es war für ein 13- und 14-jähriges Mädchen nie eine leichte Entscheidung. Die Situation dieser jungen Frauen hat meine Mutter sehr belastet, sehr wütend gemacht.
Wie war Ihre Familiensituation am Beginn Ihrer Karriere?
Als ich Mitte der 70er-Jahre "Garp und wie er die Welt sah" schrieb, hatte ich zwei kleine Kinder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester, sie waren Zwillinge. Mein Bruder ist homosexuell, meine Schwester lesbisch. Und ich höre heute noch, wie meine feministische Mutter damals gesagt hat: "Wenn Männer uns Frauen so behandeln dürfen, als ob wir eine sexuelle Minderheit wären; stellt euch vor, wie sie erst homosexuelle und lesbische Menschen behandeln, die tatsächlich eine sexuelle Minderheit sind." Was ich sagen will: Mein Umgang, meine Beschäftigung mit Frauenrechten und Rechten für Menschen, die anders sind, hat schon begonnen, lange bevor ich Schriftsteller wurde. Es hat etwas mit meiner Erziehung zu tun, mit meinem familiären Umfeld.
Wie passt diese Gesinnung mit Ihrer Passion für das Ringen zusammen, eine Sportart, in der Toleranz vermutlich nicht sehr präsent war respektive ist?
Ich war in diesem Sport natürlich immer von männlichen Athleten umgeben. Und diese Männer waren Frauen und homosexuellen Männern gegenüber, gelinde ausgedrückt, nicht sehr freundlich. Ich habe während dieser Zeit viele grobe, homophobe Witze gehört. Aber ich – der Typ, der mit einer feministischen Mutter aufgewachsen ist; ich, der Typ mit einem homosexuellen Bruder und einer lesbischen Schwester – habe immer gesagt: "Hört sofort auf damit! Hört auf mit diesen hässlichen, dummen Witzen!"
Warum ist es so schwierig, Menschen, die anders sind als die Mehrheit, Respekt und auch Liebe entgegenzubringen?
Liberale Politik und sexuelle Toleranz sind progressive Ideen. Wir wissen aus der Geschichte, dass progressive Ideen zunächst eine Abwehrhaltung hervorrufen. Und je schwieriger die Zeiten sind, desto mehr Menschen gibt es, die alles ablehnen, das ihnen fremd erscheint. In Krisenzeiten wird verstärkt nach Feindbildern gesucht. Schon die Art und Weise, wie zum Beispiel das Wort "Ausländer" ausgesprochen wird, unterstreicht diese negative Konnotation. Sprache ist sehr verräterisch. Ich erinnere mich noch gut, als ich während meiner Zeit in Österreich das Wort "Familienwerte" gehört habe und es überhaupt nicht gemocht habe, weil damit nur Werte gemeint sind, die bestimmte Politiker als "normal" bezeichnen.
Ihre Tochter Eva ist eine transgender Person. Hat das Einfluss auf Ihr Schreiben und Denken?
Ironischerweise ist es so: Weil meine Romane sehr lange in der Warteschleife sind, bevor ich sie dann tatsächlich zu schreiben beginne, habe ich die Figur des Elliot Barlow, einer transgender Person im neuen Roman, bereits im Kopf gehabt, bevor Eva ihrer Mutter und mir gesagt hat, dass sie trans ist. Unsere Tochter hatte keine Angst vor unserer Reaktion, weil sie wusste, dass wir sie lieben und unterstützen, aber sie hatte Angst davor, wie ihre Umwelt reagiert. Eva ist die Schreiberin in der Familie. Es war wunderbar, zu wissen, dass sie eine der Ersten sein wird, die meinen neuen Roman lesen. Sie hat mich auch korrigiert, was meine Transgender-Romanfigur betrifft. Das war sehr hilfreich.
Ihr Privatleben und die Leben Ihrer Romanfiguren fließen ineinander?
Ja und nein. Der Unterschied ist, dass man einen Roman planen kann – das Leben nicht. Das echte Leben ist ein Durcheinander, und vieles beruht auf Zufall.
Sie antworten immer wieder auf Deutsch. Wie lange haben Sie eigentlich in Österreich gelebt?
Insgesamt rund vier Jahre. Ich war als Student ein Jahr in Wien und bin später zurückgekehrt, um das Drehbuch für meinen ersten Roman "Lasst die Bären los" zu schreiben. Eines meiner Kinder wurde sogar in Wien geboren. Und auch zum Skifahren waren wir oft in Österreich.
Sind Sie ein guter Skifahrer?
Ich mag es, aber ich bin nicht sehr gut. Es hat mich auch frustriert, dass alle meine Kinder besser Ski fahren als ich.
Ist es noch immer so, dass Sie Ihre Romane mit dem letzten Satz beginnen?
Ja, das Ende ist das Wesentliche, es zieht und definiert den gesamten Roman. Ich bin nicht schlau genug zu wissen, was ich schreibe, wenn ich das Ende noch nicht kenne. Der literarische Held meiner Jugend, jener Mann, der in mir den Wunsch weckte, selbst Schriftsteller zu werden, war Charles Dickens. Aber er hat nie mit dem Ende begonnen. Meine Idee, mit dem Ende zu beginnen, habe ich von Melville, von seinem "Moby Dick". Melville hat gezeigt, wie gut das Ende eines Romans sein kann, wenn man bereits vorher genau weiß, was in den ersten Kapiteln passiert. Das war für mich wie eine Erleuchtung.
Sie haben immer gesagt, dass es für Sie am wichtigsten ist, die Leserinnen und Leser zu bewegen, zu berühren. Ist es schwieriger geworden, das als Schriftsteller zu schaffen?
Meine Role Models, meine Helden, waren Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Das waren große Erzähler, und ihre Geschichten waren plotgetrieben. Romane zu schreiben, die einen Plot haben, wird heute als altmodisch angesehen. Dabei ist mir gar nicht die Handlung am wichtigsten. Mir geht es um die Architektur. Meine Romane sind wie ein Haus. Noch bevor ich dieses Haus baue, weiß ich, wie viele Menschen darin wohnen und wie viele Schlafzimmer das Haus hat. Ich weiß auch, wie viele Menschen ausziehen, welche Krankheiten sie haben, wie sie sterben.
Sie sind jetzt 81 Jahre alt und wir wünschen noch viele Lebensjahre. Aber Sie haben immer gesagt, der schönste Tod wäre, am Schreibtisch zusammenzubrechen – mitten in einem Satz.
Ich möchte nicht, dass mein Tod den überlebenden Familienmitgliedern allzu viele Umstände bereitet. Und mitten im Schreiben zu sterben, das ist für mich, für einen Schriftsteller, eine schöne, romantische Vorstellung.
So liest sich der neue Irving-Roman
Für turbulente Familiengeschichten, in denen die vermeintliche Normalität bzw. Normierung der Menschen völlig auf den Kopf gestellt wird, ist der US-Schriftsteller und Oscar-Gewinner John Irving bekannt und berühmt. In seinem neuen Epos "Der letzte Sessellift" greift der Romancier noch einmal in die Vollen; hinterfragt in dieser opulenten Geschichte, die sich über mehr als 80 Jahre erstreckt, die überhebliche Ermächtigung der Mehrheitsbevölkerung und erweist sich einmal mehr als großartiger Storyteller und Menschenfreund.
Die Story beginnt in den 1940er-Jahren in Aspen, Colorado, wo Rachel Brewster als Skilehrerin arbeitet und eines Tages schwanger wird. Vater gibt es keinen, aber einen Sohn: Adam. Er führt fortan durch diesen mäandernden Erzählfluss, der auch seine Längen hat – aber welcher Roman von mehr als 1000 Seiten hat das nicht?
"Der letzte Sessellift" ist ein gewitztes, witziges, ideensprühendes und herzerweichendes Opus magnum. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Buntheit, Diversität, Toleranz. Und ein wütendes Anschreiben gegen jene, die Menschen ausschließen, die nicht konform sein wollen. Aber vor allem ist dieser Roman eines: eine wunderbare Ode an die Kraft der Liebe.
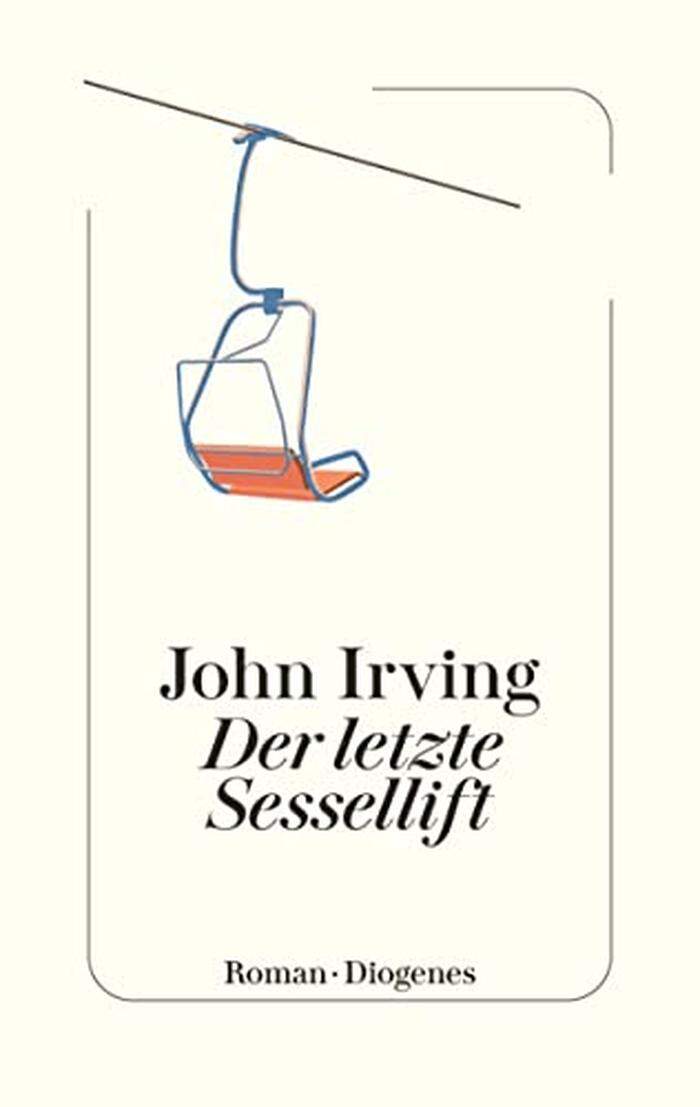
Buchtipp: John Irving. Der letzte Sessellift. Diogenes,
1067 Seiten, 38,50 Euro.

