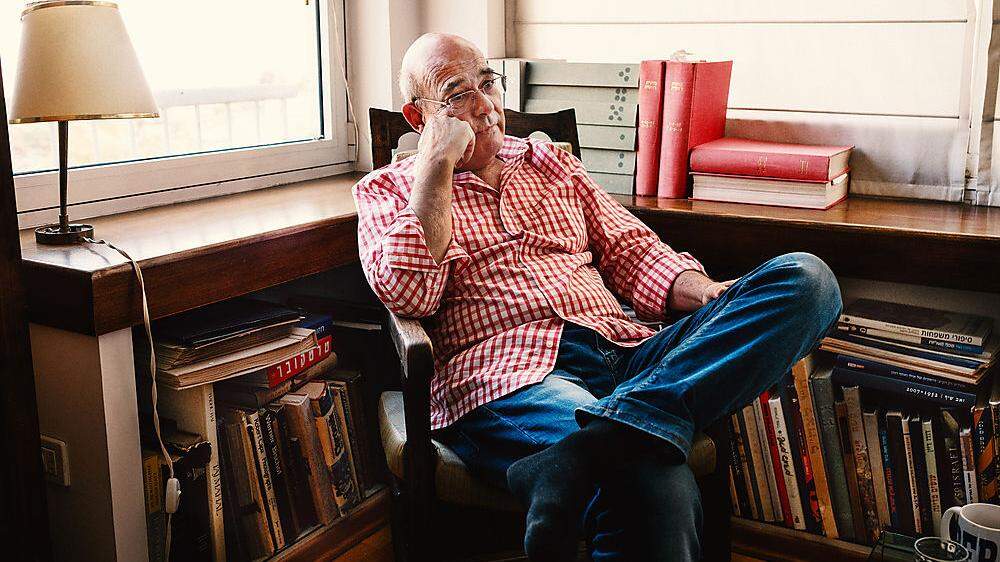Herr Segev, wie haben Sie die vergangenen zwei Wochen zwischen Raketen auf Tel Aviv und Bomben auf Gaza erlebt?
TOM SEGEV: In Jerusalem, wo ich lebe, hat sich die Lage rasch wieder normalisiert. Dabei hat hier alles mit Unruhen auf dem Tempelberg begonnen. Die Hamas hat darauf Raketen auf die Stadt abgefeuert. Das kommt sehr selten vor. Jerusalem ist eine eigenartige Stadt mit vielen Spannungen, die sich meist irgendwie ausgleichen. Dadurch ist das Leben hier mehr oder weniger erträglich. In der Nacht auf Freitag ist dann eine Waffenruhe in Kraft getreten. Man weiß nie, wie lange das hält. Doch sofort danach hat es in Jerusalem geknallt wie auf einer arabischen Hochzeit. Das sollte wohl palästinensische Siegesfreude zum Ausdruck bringen. Besonders angenehm war es nicht, aber besser als ein Raketenangriff.
Hatten Sie in den Tagen der massiven Raketenangriffe Angst?
Nein. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir so eine Eskalation erlebt haben. Aber ich war schon sehr besorgt. Ich habe einen Sohn und vier Enkel, die in Javne südlich von Tel Aviv wohnen. Die Stadt liegt in der unmittelbaren Gefahrenzone. Wenn es Raketenalarm gibt, weiß ich, dass sie betroffen sind. Die Familie schläft dann in einem betonierten Schutzraum und wird jede Nacht von den Sirenen aus dem Schlaf gerissen. Es erfüllt mich aber auch mit Sorge, dass bei den Luftangriffen der israelischen Armee im Gazastreifen so viele Zivilisten ums Leben gekommen sind, darunter auch zahlreiche Kinder. Die Menschen in Gaza tun mir sehr leid. Sie befinden sich in Geiselhaft eines abscheulichen islamistischen Terrorregimes und leiden noch dazu stark unter der Pandemie. Aus Israel kommt keine Hilfe. Auch das bedrückt mich. Wir schicken in alle Welt Impfstoffe, weil wir zu viel davon haben. Aber den Palästinensern helfen wir nicht. Das ist alles eine sehr hässliche Situation.
Sie haben sich Ihr Mitgefühl für die Palästinenser bewahrt. Sind Sie in Israel da eher die Ausnahme?
Es geht vielen so. Die meisten Israelis sind beunruhigt, weil auch diese Konfliktrunde zu nichts führen wird. Obwohl es keinen Sieger gibt, wird jede Seite behaupten, dass sie gewonnen habe. Aber an der Gesamtsituation ändert sich rein gar nichts.
War die Eskalation absehbar?
Sie kam nicht nur für mich unerwartet. Sie hat auch das israelische Militär überrumpelt, das immer so tut, als ob wir alles wüssten und die Supermänner dieser Welt wären. Tatsächlich ist es kein gutes Zeichen, dass die Hamas diesmal ganze eineinhalb Wochen Raketen auf Israel abfeuern konnte, als ob nichts wäre. Aber auch die Unruhen in Israel kamen überraschend. Im Coronajahr war viel die Rede davon, wie maßgeblich arabische Ärzte und Krankenschwestern an der erfolgreichen Eindämmung der Pandemie mitgewirkt haben. Das hat man als Indiz dafür gewertet, wie gut die Araber doch in die israelische Gesellschaft eingegliedert seien. Auch politisch. Vor der Eskalation sah es ganz so aus, als würde zum ersten Mal eine arabische Partei bestimmen, wer der nächste Premierminister wird. Und dann kommen rassistische arabische und jüdische Banden daher und beschädigen brutal das empfindliche Gewebe des Zusammenlebens in Israel.
Droht Israel ein Bürgerkrieg?
Nein, das glaube ich nicht. Keine der beiden Seiten kann ohne die andere leben. Mit den Jahren hat sich in Israel doch ein urbaner arabischer Mittelstand etabliert. Die große Mehrheit will Frieden haben. Aber die jüngsten Ausschreitungen zeigen, was für großes Unheil selbst kleine, extremistische Gruppen anrichten können. Leider ist die israelische Polizei zu schwach, um die arabische Mafia zu zerschlagen. Das wäre das Hauptanliegen der arabischen Partei, von der ich gesprochen habe. Sie will nicht etwa den palästinensischen Staat errichten, sondern die soziale Situation der Araber in Israel verbessern und bezichtigt Premier Netanjahu, dass er die Polizei mit Absicht nicht besser zur Bekämpfung der hohen Kriminalität in der arabischen Gesellschaft einsetze. Aber auch unter israelischen Juden gibt es leider rassistische Gruppierungen, die vor allem in der Fußballkultur verankert sind und Araber hassen. Es ist wirklich schlimm, wie schnell sich der Hass ausbreiten kann.
Was ist gefährlicher fürs Land: die Raketen der Hamas oder der innerisraelische Ausbruch von Hass?
Mich beunruhigen die Ausschreitungen im Land viel mehr. Der Krieg mit der Hamas ist nur eine weitere Episode in einem langen Konflikt, der schon über 100 Jahre andauert und sich von Zeit zu Zeit gewaltsam Bahn bricht. Man erwartet dann immer, dass Israel dafür sorgt, dass die Palästinenser nicht mehr Raketen abfeuern können. Mit Recht. Es gibt an der Grenze zum Gazastreifen eine Reihe von israelischen Dörfern. Die Bauern dort bewirtschaften das ganze Jahr über ihre Felder. Kurz vor der Ernte dann schicken palästinensische Schulkinder brennende Luftballons herüber. Das Leben ist auch auf israelischer Seite hart, wenngleich es in Gaza viel härter ist. Die Leute dort haben weder Arbeit noch medizinische Versorgung. Und das Schlimmste ist, dass es keine Hoffnung gibt. Als 14-Jähriger hat man überhaupt keine Zukunftsperspektive. Gaza ist wirklich einer der fürchterlichsten Orte der Welt.
Die Europäer haben wieder einmal jede Menge Ratschläge für Israel parat. Sind sie sich der Komplexität des Konflikts bewusst?
Ach, Europa! Offen gesagt interessieren mich die europäischen Reaktionen nicht wirklich. Auch wenn Ihr Kanzler am Ballhausplatz den Davidstern hissen lässt, ändert das nicht viel in Israel. Ich mache jetzt schon so viele Jahre lang diese Situation mit, dass ich jeden Optimismus verloren habe. Das war nicht immer so. Hätten Sie mich vor vierzig Jahren angerufen, dann hätte ich Ihnen gesagt, dass wir 2021 längst Frieden und die Kriege vergessen haben werden. Und wenn ich die Situation historisch betrachte, dann gibt es ja durchaus Konfliktlösungen etwa in Südafrika oder in Nordirland, von denen man meinte, dass es sie nie geben würde. Aber bei Israelis und Palästinensern bin ich inzwischen pessimistisch. Dieser Konflikt ist nicht lösbar. Man kann ihn nur managen. Und er wird sehr oft nicht gut genug gemanagt.
Warum ist er nicht lösbar?
Weil es ein Konflikt zwischen zwei Völkern ist, von denen jedes seine Identität über den Anspruch auf das ganze Land definiert. Jeder Kompromiss würde dazu führen, dass jede Seite einen Teil ihrer Identität preisgeben müsste. Dazu sind weder Israelis noch Palästinenser imstande und willens.
Was bedeutet das für die Zweistaatenlösung?
Die Zweistaatenlösung ist tot. Sie lebt nur noch in den Papieren, die europäische und amerikanische Staatsoberhäupter auf ihren Schreibtischen vor sich liegen haben. Mittlerweile lebt eine halbe Million Israelis in den besetzten Gebieten. Den staatsmännischen Mut, ihnen zu sagen, sie müssen ihre Siedlungen räumen, hat Netanjahu nicht – auch weil es in Israel dafür keine Mehrheit gibt. Wäre ich umgekehrt Palästinenser, so würde ich mich vielleicht fragen, ob der Tempelplatz in Jerusalem wirklich so viele Menschenleben wert ist. Die Schwierigkeit dieses Konfliktes ist, dass Nationalität und Religion in ihm verschmelzen. Daher ist es so schwierig, einen Kompromiss zu finden. Alles ist schon einmal vorgeschlagen worden. Doch es gibt keine Mehrheit dafür – auf keiner Seite. Und so gibt es nur bessere und schlechtere Zeiten. Und ab und zu explodiert dann die Lage. Solche Tage stimmen mich besonders traurig.
Bedauern Sie es in solchen Momenten, Israeli zu sein?
Nein. Wir waren 2000 Jahre lang Wanderer in der Welt. Jetzt sind wir keine Wanderer mehr, auch meine Kinder nicht. Neulich war ich mit meinem Sohn zusammen. Wir haben den Enkeln zugeschaut. Und ich habe ihm gesagt: „Wenn die groß sind, hat sich bei uns hier immer noch nichts geändert. Warum gehst du nicht nach Australien?“ Er ist Elektroingenieur und würde im Ausland jederzeit Arbeit finden. Doch mein Sohn blickt mich an und sagt: „Ich lebe in Javne. Was soll ich in Australien?“ Und er hat recht. Wenn man in einem Land geboren und aufgewachsen und eins mit seiner Sprache, Kultur und Mentalität ist, dann ist es keine Option, morgen woanders zu leben. Meine Eltern mussten aus Deutschland nach Palästina emigrieren. Meine Enkel sollen einmal dort leben, wo sie glücklich sind. Das muss nicht Israel sein. Ich wünsche ihnen nur, dass sie niemals in die Situation ihrer Urgroßeltern geraten, ihr Heimatland verlassen zu müssen.