Faustregeln haben etwas für sich. Zum Beispiel, dass eine Kilowattstunde Strom immer so um die 20 Cent kostet. Da bekommt man natürlich schnell das Grinsen, wenn man sich so ausrechnet, was das
Betanken eines E-Mobils mit 60-kWh-Akku kostet. Fast nichts – oder in der Realität: harmlose 12 Euro, die bei modernen Elektroautos für mindestens 300 Kilometer gut sein können. Diese Autos sollen also nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geldbörserl schonen. Das lässt sogar die längeren Ladezeiten in einem anderen Licht erscheinen. Doch spätestens jetzt tritt eine zweite, uralte Faustregel in Kraft: Man darf die Rechnung nie ohne den Wirt machen. Und in unserem Falle bedeutet das: die Betreiber der öffentlichen Ladestationen. So kann es nämlich sein, dass man für eine Aufladung in Wien 55 Euro zahlen muss, in der Steiermark sogar an die 80 Euro.
Wie kann das sein? Die Ladenetzbetreiber verwenden hierfür einen kleinen Trick: Sie nennen sich selbst viel lieber „Mobility Service Provider“, also Dienstleister für Mobilität. Und als solcher kann man sich die veranschlagten Tarife mehr oder weniger nach eigenem Gutdünken aussuchen. Die Arbeiterkammer hat sich dieses Themas bereits angenommen und erstaunliche Differenzen feststellen müssen: Hierzulande wird nicht nach Amperestunden, sondern nach der Standzeit am Lader abgerechnet (man zahlt also auch dann noch, wenn der Akku schon längst wieder aufgeladen ist), und diese Minutenpreise unterscheiden sich teils um das Zwölffache.

Unterschiede im dreistelligen Eurobereich sind durchaus möglich, wobei ein weiteres Problem darin besteht, dass an den Säulen nicht angeschrieben steht, mit welcher Leistung der Strom aus der Leitung fließt. Natürlich ist es gerechtfertigt, mehr zu verlangen, wenn die Amperezahl entsprechend höher liegt. Nur können vor allem kleine, billigere E-Mobile dieses Potenzial gar nicht ausschöpfen, da ihr Onboard-Lader die hohen Ströme gar nicht verarbeiten kann. Im Gegensatz zu den hochpreisigen Modellen, was zu einer skurrilen Tatsache führt: Wer ein Luxusmobil fährt, tankt oftmals günstiger. So wie zu den Anfängen der Handys vor mehr als 20 Jahren gibt es derzeit bei der Ladeinfrastruktur einen Tarifdschungel mit Datenpaketen, Roaminggebühren und Mitglieds vorteilen, in dem diverse Unklarheiten lauern.
Wie das sein kann, ist eine typische Geschichte österreichischer Lösungen. Alles fing mit einer gut gemeinten EU-Richtlinie an. Die schrieb vor, dass die Preise für die gezapften Am pere an Ladestationen im öffentlichen Raum transparent und vergleichbar sein müssen. In der Praxis wäre das mit horrenden Kosten verbunden gewesen, denn besagte Ladesäulen sind praktisch alle nicht geeicht. Also wuchtete man die Richtlinie juristisch aufs Abstellgleis, indem man sie bei der Umsetzung ins heimische Recht in die Erläuterungen verbannte und sie somit nicht mehr bindend war. Das ist alles natürlich keine attraktive Ausgangsbasis, um sich für ein E-Mobil zu entscheiden.
Die Frage sei also durchaus erlaubt: Wie konnte man es so weit kommen lassen? „Wir haben darauf keinen Zugriff. Und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es nämlich überhaupt keine privaten Ladestellen“, sagt Daniel Hantigk, zuständig für das Ladenetz bei E-Control, der österreichischen Regulierungsbehörde für die Strom- und Gaswirtschaft, über das Zeitabrechnungsmodell. „Ansonsten müsste jeder Betreiber nämlich ein Stromlieferant werden und dafür gäbe es aus guten Gründen sehr große Hürden zu überwinden. Die jetzige Regulierung ist zur Unterstützung privater Initiativen also zuerst einmal als positiv zu bewerten. Hat aber den Pferdefuß, dass wir uns nicht drum kümmern können.“
Das heißt also: Der Regulierungsbehörde sind die Hände gebunden. „Unser Regularium endet beim Stromzähler. Auf alles danach haben wir keinen Zugriff mehr. Und da ist es egal, ob dann nur eine Kaff eemaschine in einem Schanigarten betrieben oder eben Strom an Autos weitergegeben wird“, erklärt er. Wie geht man jetzt also am besten weiter vor? „Wir sehen, dass mehr Transparenz wichtig wäre. Das ist unser Ansatz.“ Und auch der Gesetzgeber ist sich dieses Themas durchaus bewusst. „Es ist auch schon auf der To-do-Liste. Wie weit oben aber, können wir nicht sagen“, sagt Hantigk. Und die Probleme fangen damit gerade erst einmal an: „Es muss zum Beispiel noch geklärt werden, ob es sich bei der Problematik um ein Wettbewerbs- oder Verkehrsthema handelt, ob also das Wirtschafts- oder das Verkehrsministerium dafür zuständig ist. Man steht also noch völlig am Anfang, zumindest wenn man die E-Mobilität wirklich weit verbreiten möchte.

Aber das gilt auch für die Unternehmen. Ladestationen sind immense Investitionen und jetzt beginnt dieses Geschäftsmodell erst langsam, sich zu etablieren“, sagt der Experte. Wirklich Geld verdient hat mit den Stromsäulen also noch niemand und zum Tragen kommen die Kurzschlüsse in den derzeitigen Verrechnungsmodellen ohnehin erst in einigen Jahren. „Problematisch wird es erst dann, wenn die breite Masse auf Elektroautos umsteigt. Da wären auch große Regulierungen, egal ob die Abrechnung nach Kilowattstunden oder nach Minuten geht, nicht notwendig, sondern erst einmal Transparenz. Dass es einen Kalkulator gibt, dem alle Anbieter ihre Preise melden müssen.“ Die Erfahrungen zeigen aber, dass es kaum einen Nutzer gibt, der unvorbereitet seinen nächsten Ladeplatz ansteuert.
Hantigk: „Die Profis haben schon sieben oder acht verschiedene Ladekarten, aber so weit muss man ja gar nicht gehen. Wichtiger wäre es, sich einmal in Ruhe anzusehen, welche Verträge und Karten es gibt, und vor allem, welches Ladeverhalten ich habe und welcher Anbieter dann für mich der beste ist. Optimal wäre es da natürlich, meine Situation dann auf unserer Homepage in einen Rechner einzugeben, um gleich zu wissen, was man wo zahlt. Aber dafür müssten zuerst die Gesetze verändert werden.“
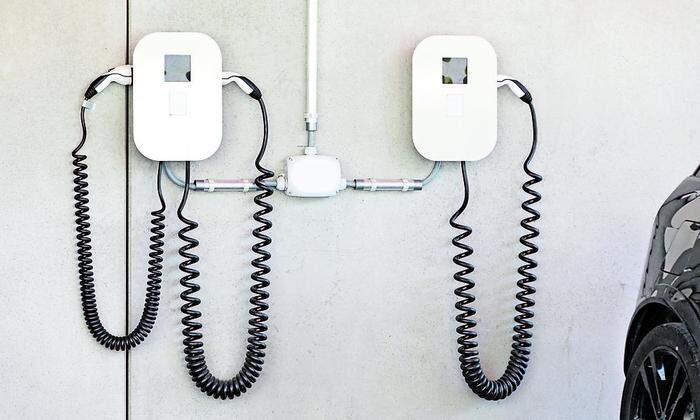
Das Ladeverhalten – ein gutes Stichwort. Denn gerade dieser Punkt ist eines der essenziellsten Details im Ausbau der kompletten Infrastruktur. „Vom Ladenetz her sind wir mittlerweile schon ganz gut ausgebaut. Das große Fragezeichen, um das wirklich beurteilen zu können, bleibt aber, wie viel die Leute daheim laden werden. Bislang geht man von 80 bis 90 Prozent aus“, sagt Hantigk. Hier gibt es noch keinerlei Erfahrungswerte, auf denen man den Ausbau stützen könnte. Und die sogenannten „Early Adopters“, also jene, die schon sehr früh auf den E-Auto-Zug aufgesprungen sind, gehören meist zu den Betuchteren, die oft ein Eigenheim mit der Möglichkeit, eine eigene Wallbox zu installieren, haben. Was aber, wenn auch Otto Dieselverbraucher in großer Zahl plant, auf diese Antriebsform umzusteigen? „Daheim über Nacht langsam zu laden, wäre natürlich das Vernünftigste“, so Hantigk. „Da hat man natürlich die beste Verteilung. Wenn man überall Schnellladestellen errichten müsste, wäre das dann auch für das Stromnetz an sich ein Problem.“ Würden aber nur 50 Prozent die Möglichkeit haben, in den eigenen vier Wänden ihr Vehikel anzustöpseln, sähe die Geschichte schon ganz anders aus.
