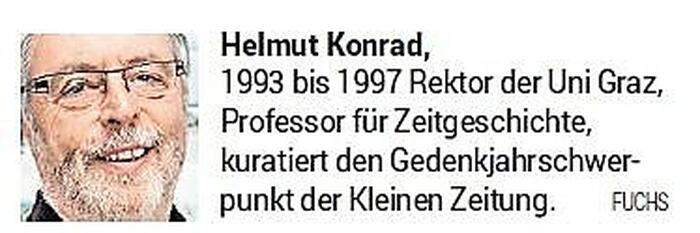n den Jahren zwischen den Weltkriegen war das Herstellen von Hegemonie im politischen Diskurs neben den Printmedien vor allem dem Erscheinungsbild im öffentlichen Raum geschuldet. Der öffentliche Raum war allerdings schon sehr viel länger ein heftig umkämpfter Schauplatz. Es ging bei dessen Besetzung um kontroversielle Erscheinungsbilder, um Repräsentation, vor allem aber auch um das Setzen von Denkmälern und damit um das Beherrschen der kollektiven Erinnerung.
Das Erkämpfen der imperial-großbürgerlichen Ringstraße durch die Arbeiter Wiens in den Maiaufmärschen kann exemplarisch für diese Auseinandersetzung stehen. Öffentlichen Raum gibt es aber nicht nur in den großen Städten. Jeder Markt- oder Dorfplatz kann als solcher gelten, praktisch jeder Bahnhof, jedes Kino, jede größere Gaststube. In den Jahren der Zwischenkriegszeit, als sich die Wehrverbände der Parteien formiert hatten und paramilitärisch auftraten, war mehr als einmal auch das Dorf Schauplatz des Ringens um die Hegemonie in der öffentlichen Wahrnehmung. Diese Versuche, die Straße zu beherrschen, führten mehr als einmal zu blutigen Konflikten.
Es sollte in der gesamten Ersten Republik kein Jahr ohne blutige politische Gewalt bei diesem Ringen um die Hegemonie geben. Gewalt war also Alltag, zumal die Wehrverbände nicht weniger als 180.000 Mann in ihren Formationen hatten, denen ein Bundesheer aus nur 30.000 Berufssoldaten gegenüberstand. Der Staat hatte also kein Gewaltmonopol, und der „Große Krieg“ hatte die Hemmschwelle zum Einsatz von physischer Gewalt in dramatischer Weise abgesenkt.
Ein Ereignis und ein Jahr ragen aus der Kette der blutigen Auseinandersetzungen heraus. Es sollte sich im burgenländischen Dorf Schattendorf abspielen. Das Burgenland, das eine Sonderstellung unter den Bundesländern hatte, da es erst 1921 als selbstständiges und gleichberechtigtes Bundesland in die Republik Österreich aufgenommen wurde, was aber noch keinesfalls ein Ende der Kämpfe um diesen Landstrich bedeutete, war ein besonderer Schauplatz. Hier mischten sich sprachnationale mit politischen Gegensätzen und machten die Lage besonders explosiv.
Schattendorf war eine sozialdemokratisch geführte zweisprachigeGemeinde. Am 30. Jänner 1927 hielten die rechtsgerichteten Frontkämpfer in „ihrem“ Gasthaus, dem Gasthaus Tscharmann, eine Versammlung ab. Die Schutzbündler, unterstützt durch Gesinnungsgenossen, die mit der Bahn eintrafen, hielten in etwa 500 Meter Entfernung eine Gegenkundgebung ab und dominierten sehr rasch auf der einzigen zentralen Straße des Dorfes. Als sie lautstark vor dem Gasthaus Tscharmann auftauchten, fielen aus dem Gasthaus heraus Schüsse, die unter den linken Demonstranten den kroatischen Kriegsinvaliden Matthias Csmarits und das Kind Josef Grössing (aus dessen Familie der spätere Staatssekretär Josef Ostermayer stammt) tödlich verletzten. Die drei Schützen aus dem Gasthof wurden verhaftet und der Justiz übergeben.
Wer durch die Medien der Folgewochen blättert, kann ein gutes Bild über das Ringen um die Deutungshoheit der Ereignisse gewinnen. Von Mördern sprach die eine Seite, von Notwehr die andere, und diese mediale Verarbeitung sollte nicht ohne Einfluss auf den späteren Prozessverlauf bleiben.
Der Prozess gegen die drei Angeklagten, Josef Tscharmann, Hieronymus Tscharmann und Johann Pinter, wurde in Wien geführt. Es war ein Geschworenenprozess, und gerade die Geschworenengerichte waren eine alte Forderung der Sozialdemokratie, die in solchen Gerichten ein Mittel gegen die sogenannte „Klassenjustiz“ zu erblicken vermeinte. Die zwölf Geschworenen, die für diesen Prozess aufgeboten wurden, stellten auch weitgehend einen fairen, repräsentativen Querschnitt durch die österreichische Gesellschaft dar und hatten wohl im Vorfeld durch unterschiedliche Zeitungen ihre unterschiedliche Vorprägung erhalten. Ein Drittel der Geschworenen waren Arbeiter, drei waren Beamte. Es gab eine Hausfrau, zwei Bauern und zwei Gewerbetreibende.

Die Anklage umfasste Mordabsicht und absichtlich schwere Körperverletzung. Das war so formuliert, dass es die Alternative, nämlich Notwehrüberschreitung, im Prozess der Wahrheitsfindung ausschloss. Der Staatsanwalt plädierte auf schuldig und die knappe Mehrheit der Geschworenen, sieben der zwölf, folgte ihm auch. Dadurch war aber die notwendige Zweidrittelmehrheit um eine Stimme verfehlt. Der Richter hatte daher einen Freispruch zu verkünden, eine Entscheidung, die er am 14. Juli 1927 bekannt gab. Obwohl der Prozess formal korrekt abgelaufen war, musste das Urteil empören. Man hatte die Schützen, man hatte zwei weitgehend unbeteiligte Tote, und nun kam, trotz des klaren Sachverhalts, dieser Freispruch.
In der Arbeiterzeitung erschien am folgenden Morgen ein Leitartikel des Chefredakteurs Friedrich Austerlitz, der den Titel trug: „Die Mörder von Schattendorf freigesprochen!“ Austerlitz setze in seinen Artikeln sehr oft den austromarxistischen, von Otto Bauer vorgegebenen taktischen Weg des radikalen Worts, das die pragmatische Politik verhüllen sollte, um. Diesmal aber wurde der radikale Text, dass sich die Arbeiter dieses Schandurteil nicht gefallen lassen würden, ernst genommen. Der Massenprotest dieses Tages verlief spontan und damit weitgehend außerhalb der Kontrolle der Sozialdemokratischen Partei.
Die Direktion der Städtischen Elektrizitätswerke stellte den Strom für die Straßenbahn ab, ein Signal für die organisierte Arbeiterschaft, sich auf die Straße zu begeben. Eine große Gruppe zog vom E-Werk zum Ring und versuchte, das Hauptgebäude der Universität zu stürmen, was angesichts des Gegenstandes der Demonstration wohl nicht sehr sinnvoll erscheint. Man verwüstete die Redaktionsstube der „Neuesten Wiener Nachrichten“, wurde von Sicherheitskräften aber daran gehindert, sich dem Parlament zu nähern. Daher bog man nach Süden zum Justizpalast ab, der durchaus ein Symbol für die verhasste „Klassenjustiz“ abgab. Die Massen agierten ohne Führungspersönlichkeiten. Ganz im Gegenteil: Der Bürgermeister von Wien, Karl Seitz, der Schutzbundführer Theodor Körner und Funktionäre des Schutzbundes stellten sich den Demonstranten entgegen und versuchten zu beruhigen. Die Masse aber befand sich im Ausnahmezustand. „Ich wurde ein Teil der Masse, ich ging vollkommen in ihr auf, ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm“, sollte rückblickend Elias Canetti in seiner „Fackel im Ohr“ schreiben, und das Thema „Masse und Macht“ ließ den großen Autor zeitlebens nicht mehr los.
Um die Mittagszeit gingen im Parterre des Justizpalastes Scheiben zu Bruch und Demonstranten hatten sich einen Weg zum Eindringen in das Gebäude verschafft. Um 12.28 Uhr ging der erste Notruf bei der Feuerwehr ein. Akten und Mobiliar wurden angezündet, Rauch quoll aus den Fenstern. Die Feuerwehr versuchte, sich durch die Menschenmassen vorzuarbeiten, aber der Löscheinsatz wurde behindert, Wasserversorgungsschläuche wurden von den Demonstranten zerschnitten. Theodor Körner gelang es, die Wachebeamten des Justizpalastes aus ihrer misslichen Lage zu befreien, indem er sie als Verletzte getarnt aus dem Gebäude tragen ließ. Aber es gelang auch Körner nicht, die Massen zu beruhigen.
Gegen 18 Uhr brannten fast 10.000 Quadratmeter Fläche im Justizpalast. Die Akten des Innenministeriums, des Justizministeriums, des Ministerrats und der Gendarmerie aus der Zeit der Jahrhundertwende verbrannten oder wurden zumindest angekohlt. Man nennt sie bis heute „Brandakten“.
Als Präsident der Wiener Polizei fungierte 1927 Johannes Schober, ein Mann, der schon Bundeskanzler gewesen war und zu den bekanntesten und umstrittensten Politikern der Ersten Republik zählte. Da seine Polizei schlecht ausgerüstet war, forderte er den Assistenzeinsatz des Bundesheeres an, was Bürgermeister Karl Seitz aber verweigerte. So rüstete Schober im Alleingang seine unerfahrenen Polizeitruppen mit Waffen aus den Heeresbeständen aus. Die unerfahrenen, überwiegend jungen Polizisten hatten solche Waffen vorher nicht in Händen gehalten. Als die ersten Schüsse fielen, versuchten die Menschen in Panik, vom Platz vor dem Justizpalast zu fliehen. Wohl ebenfalls in Panik schossen die Polizisten den Fliehenden nach.
Bei Einbruch war die Opferbilanz grauenvoll: 89 Demonstranten und fünf Sicherheitsbeamte lagen tot auf der Straße. Die Zahl der Verletzten lag auch offiziell bei weit über 1000, viele aber hielten sich aus Angst vor Konsequenzen verborgen. Der Brand des Justizpalastes war erst in den Morgenstunden des 16. Juli unter Kontrolle.
Nach den dramatischen Ereignissen des 15. Juli 1927 war es unmöglich, einfach zur Tagesordnung zurückzukehren. Karl Kraus, der scharfzüngige Intellektuelle, ließ auf eigene Kosten eine Botschaft an den Polizeipräsidenten Schober plakatieren: „Ich fordere Sie auf abzutreten.“ Im Parlament gingen die Wogen ebenfalls hoch. Ignaz Seipel, der Bundeskanzler, führte am 26. Juli aus: „Verlangen Sie nichts vom Parlament und von der Regierung, das den Opfern und den Schuldigen an den Unglückstagen gegenüber milde erscheint, aber grausam wäre gegenüber der verwundeten Republik.“ Postwendend erhielt er von der Linken das Prädikat „Prälat ohne Milde“, ein wenig schmeichelhafter Ehrentitel, den er nicht mehr loswerden sollte.
Aber auch die Sozialdemokratie musste erkennen, wie gefährlich ihr Spiel der radikalen Worte tatsächlich war. Wohl bewahrte das die politische Einheit der Linken, stieß aber nachhaltig an Grenzen, als die sogenannten „Massen“ die Phrasen wörtlich nahmen und der Kontrolle der Parteiführung vollständig entglitten. Der Öffentlichkeit wurde vor Augen geführt, dass im Ernstfall die Partei nicht bereit schien, eine revolutionäre Situation auszunutzen, sie auf die Spitze zu treiben und eine Revolution loszutreten. Sie hatte sich als beruhigende Kraft erwiesen, dabei aber auch sich selbst in den Augen ihrer politischen Gegner entlarvt. Die realen Machtverhältnisse hatten sich also, trotz der Sympathieerklärungen der meisten Intellektuellen, mit den Juli-Ereignissen zuungunsten der Sozialdemokratie verschoben.
Die dramatischen Ereignisse des 15. Juli 1927 wurden von allen Seiten instrumentalisiert. Klassenjustiz stand gegen Revolutionsfurcht, die Auseinandersetzungen nahmen an Schärfe deutlich zu. Die Schuldfrage ist, abgesehen vom Schießbefehl Schobers, nur schwer eindimensional zu beantworten. Da gab es Strukturen, es gab Eigendynamiken, ideologische Scheuklappen und vor allem ein Verkennen des Potenzials, das in der sogenannten „Masse“ steckt, die sich, einmal in Bewegung, nicht mehr wirklich steuern lässt. Die Republik aber steuerte mit neuer Geschwindigkeit auf den Abgrund zu.