Herr Hauck, Sie haben einen Suizidversuch und einen längeren Aufenthalt in der Psychiatrie hinter sich. Wie geht es Ihnen heute?
Uwe Hauck: Heute geht es mir gut, ich bin stabil. Das Suizidrisiko ist weitestgehend weg.
Sie haben auch ein Buch geschrieben, „Depression abzugeben“. Sie wissen aber, dass Sie die Krankheit nicht mehr loswerden. Wie leben Sie damit?
Uwe Hauck: Am Anfang war die Krankheit mein Feind, heute sage ich: Die Depression ist ein Teil von mir. Ich komme zum Glück nicht in diese absoluten Tiefs, bei denen man nur im Bett bleiben kann. Aber ich habe Phasen, in denen es mir schlecht geht, in denen ich sehr gereizt bin und mich alles überfordert. Doch dadurch, dass ich weiß, was mit mir los ist und dass es auch meine Familie weiß, ist es für alle nicht mehr so schwierig. Schon durch die Erkenntnis, ich habe eine Depression, habe ich viel gewonnen.
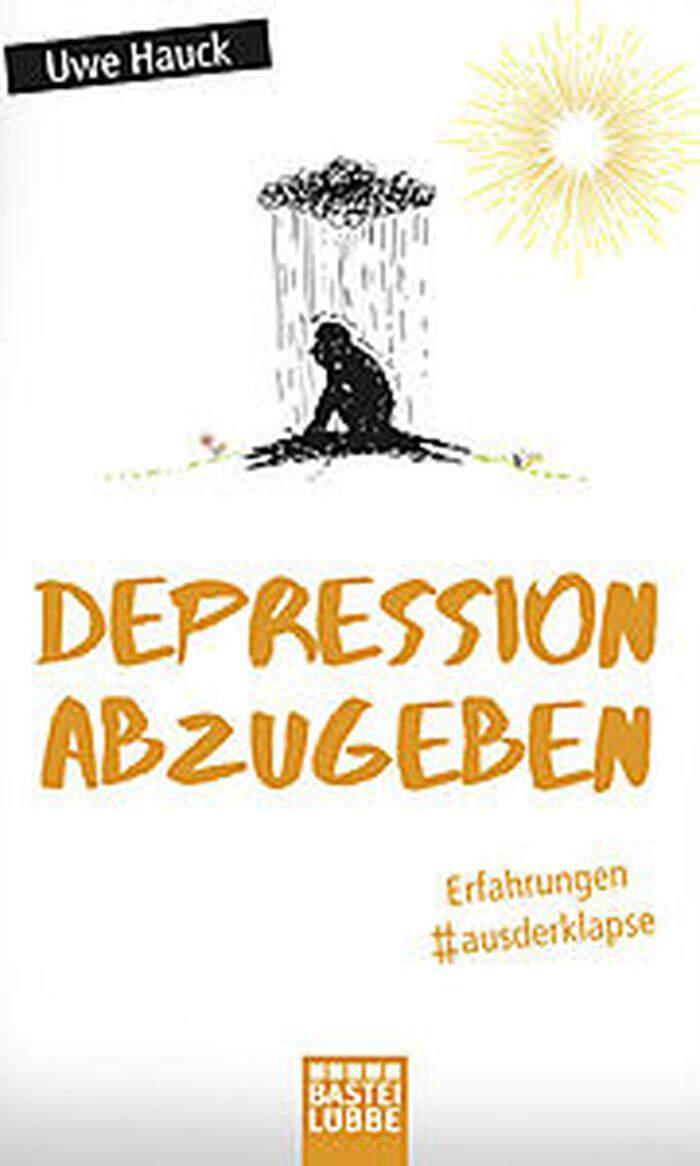
Es ist schwierig, anderen zu erklären, wie es einem Depressiven geht. Wie haben Sie das bei Ihren drei Kindern gemacht?
Uwe Hauck: Meinen Kindern habe ich versucht zu erklären, dass ich in der Depression völlig gefühllos, völlig leer bin. Ich verwende ein Bild, um zu beschreiben, wie sich diese Tiefe anfühlt: Es ist, wie wenn man mit Freunden ins Schwimmbad geht und ins Wasser springt. Die Freunde tauchen auf, man selbst will auch auftauchen, doch man knallt gegen eine Eisdecke. Die Freunde wollen einen rausholen, sagen, da ist doch gar nichts, weil sie die Eisdecke nicht sehen können. Doch man selbst merkt, dass man ertrinkt.
Unter #ausderklapse haben Sie aus der Psychiatrie getweetet. Wie hat Ihnen das geholfen?
Uwe Hauck: Ich war schon davor auf Twitter aktiv und habe nach einer gewissen Zeit in der Psychiatrie gesehen, dass sich viele Sorgen gemacht haben, ob mir was passiert sei. Ich hätte lügen können oder die ganze Wahrheit sagen. Und so habe ich in Tweetform erzählt, was ich erlebe. Es hat mir gutgetan, weil ich mich auf andere Art mit der Situation auseinandergesetzt habe. Es ist etwas anderes, ob man mit Mitpatienten spricht oder mit einer unbedarften Öffentlichkeit.
Welche Reaktionen gab es?
Uwe Hauck: Die schönsten Rückmeldungen waren von Menschen, die geschrieben haben: Was du beschreibst, kenne ich von mir. Jetzt gehe ich zum Arzt und lasse mich beraten.

Sie verwenden im Buch sehr negative Begriffe wie „Irrenanstalt“ oder „wir Verrückten“: Das trägt doch zur weiteren Stigmatisierung bei, warum tun Sie das?
Uwe Hauck: Für mich war der Hashtag „Aus der Klapse“ eine bewusste Provokation. Ich wollte Menschen den Spiegel vorhalten: Ihr denkt von der Klapse so oder so, und ich erzähle euch, wie es dort wirklich ist.
Noch immer existieren viele Vorurteile gegenüber psychisch Kranken: Haben auch Sie Berührungsängste erlebt?
Uwe Hauck: In meinem Umfeld wurden jene Menschen ausgefiltert, mit denen ich mich ohnehin nicht hätte umgeben sollen. Gleichzeitig habe ich durch die Krankheit Leute kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte.
Was, denken Sie, müsste sich ändern, damit die Depression als das wahrgenommen wird, was sie ist - eine Krankheit?
Uwe Hauck: Das Stigma muss weg, dass eine psychische Krankheit einen verrückt macht. Leider haben viele das Bild: Du bist psychisch krank, deshalb bist du unkontrollierbar und gefährlich. Ich war gerade zu der Zeit in der Klinik, als der Germanwings-Flieger abgestürzt ist. Schon kurz danach kamen die ersten Vermutungen, dass der Pilot Depressionen hatte. Das kann ja sein, aber was hat das damit zu tun, dass er Menschen in den Tod gerissen hat? Das war sein Charakter. Diese Vorurteile sind so gefährlich, weil Betroffene denken: Ich gehe lieber nicht zum Arzt, sonst halten mich alle für verrückt.




