Es sei, schrieb er 1941 in der Widmung an seine Frau Carlotta, ein Stück „über einen alten Kummer, geschrieben mit Tränen und Blut“. Testamentarisch verfügte er, dass es erst 25 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfe.
Carlotta hat sich nicht daran gehalten. 1956, drei Jahre nach Eugene O'Neills Tod, wurde „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ in Schweden ur- und noch im selben Jahr am Broadway erstaufgeführt, 1957 erhielt O'Neill dafür posthum den Pulitzer-Preis und den Tony Award für das beste Stück. Bis heute gilt es als Opus magnum des Literaturnobelpreisträgers von 1936.
Nachgefragt wie "Warten auf Godot"
Viel wird von ihm sonst derzeit nicht gespielt: „Trauer muss Elektra tragen“ war zuletzt 2011 in Berlin zu sehen, „Ein Mond für die Beladenen“ 2010 in München. „Der haarige Affe“ erlebte in den letzten drei Jahren zwei Produktionen, „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ dagegen ganze 15. Derzeit läuft das Stück in Hamburg, München, Stuttgart, demnächst in Bremen, Dresden und am Deutschen Theater in Berlin. In Wien inszeniert Andrea Breth in Luxusbesetzung: mit Sven-Eric Bechtolf, Corinna Kirchhoff, Alexander Fehling und August Diehl. Seit 2010, erzählt Ulrike Betz vom S. Fischer Theaterverlag in Frankfurt, ist das Stück aufgerückt zu den moderner Klassikern, wird ähnlich oft angefragt wie Becketts „Warten auf Godot“, Edward Albees „Wer hat Angst vor Virgina Woolf?“, Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“.
O'Neills Exegeten sind sich einig: Fast unverhüllt erzählt das Stück die Familiengeschichte des Autors, fiktionalisiert und komprimiert in einen Tag im Sommerhaus der Familie Tyrone. Die Mutter ist eine unheilbare Morphinistin. Der Vater, ein einst gefeierter, dann verkommener Schauspieler, ertränkt sein Elend im Suff, die beiden Söhne tun es ihm gleich; der jüngere ist noch dazu an Tuberkulose erkrankt. Vier Akte lang umschleichen, kränken, verletzen die vier einander mit alten Geschichten: Gespenster, die durch die Vergangenheit irren.
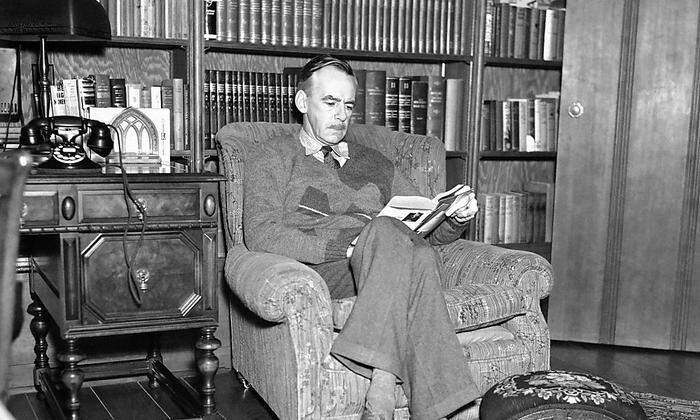
Familiäre Bande als gordischer Knoten
Bei all dem wirkt diese familiäre Tragödie wie eine üppige Oase vor der kargen Landschaft des postdramatischen Theaters: reich an geschliffenen Dialogen und komplexen Beziehungsgeflechten, an wildem Aufbegehren und resignierter Emotionalität. Kein Wunder, dass Regisseure und Schauspieler das Stück lieben. Für Sven-Eric Bechtolf, der in der Vaterrolle an die Burg zurückkehrt, ist „die verzweifelte Energie, mit der die Beteiligten sich aneinander abarbeiten, paradoxerweise auch ein Beweis der Liebe, die sie füreinander haben“. Vielleicht ist also auch das ein Grund für die Renaissance des Werks: In Zeiten wachsender sozialer Unsicherheit zeigt es familiäre Bande als gordischen Knoten - würgend, aber auch tröstend unauflöslich.

